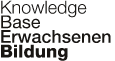Tradition versus Innovation. Untergang kultureller Werte oder Abbau von Barrieren?
Titelvollanzeige
| Autor/in: | Liessmann, Konrad Paul |
|---|---|
| Titel: | Tradition versus Innovation. Untergang kultureller Werte oder Abbau von Barrieren? |
| Jahr: | 1994 |
| Quelle: | Volkshochschule Rudolfsheim-Fünfhaus (Hg.): Video Hoc Scriptum; What You See Is What You Get. 7. Steyrer Symposion, 4.3. bis 6.3.1994. Wien 1994, S. 175-189. |
[S. 175] Sie sind da: die Neuen Medien. Die Computer und Monitore, Datenbanken und Vernetzungen, Laser-Printer und Textverarbeitungssysteme halten Einzug in die Betriebe, Wohnungen, Kindergärten, Schulen und Universitäten. Die alten Kulturtechniken scheinen bedroht, die am Computer simulierten Welten sehen manche schon als ein umfassendes neues Bezugssystem für unsere Formen des Wissens und Handelns. Was Gesamtschule und Bildungsreform, Fernsehen und Schundromane nicht geschafft haben, könnte dem Computer im Handumdrehen gelingen: die Destruktion der abendländischen Kultur, der seit Humboldt tradierten Bildungsidee, die sich einem literaten Wissen verpflichtet fühlte. Die Kommentare oszillieren deshalb auch zwischen apokalyptischen Visionen, die den PC am Schreibtisch mit dem Untergang aller Kultur verwechseln, und euphorischen Träumen, die die gelungene Zusammenführung zweier Texte via Computer für die universale Vernetzung aller Information, für die Sistierung von Raum und Zeit halten. Wie negativ oder affirm die Kulturtheoretiker dem digitalen Zauber auch gegenüberstehen mögen: gequält oder triumphierend verkünden sie eines: das Ende des Buches, den Zusammenbruch der „Gutenberg-Galaxis“.
Werfen wir zuerst einen kursorischen Blick auf einige Phänomene der Digitalisierung der Welt und deren Deutungen. Die Unsicherheit, wie diese Digitalisierung unser Leben und unsere Kultur verändern wird, hat, bedingt durch die rasante Entwicklung der Microcomputer, nicht ab-, sondern zugenommen. Je mehr sich der technologische Innovationsprozeß beschleunigt, desto schneller verlieren nämlich Prognosen [S. 176] und Prophezeiungen an Wert. Galt in der Frühzeit des Computers die Idee des Roboters, also der dienstbare elektronische Geist, als zukunftsträchtige Vision, so zeigte sich bald, daß dieser personale Zugang zur Maschine so wenig Chancen auf Realisierung hat wie ein Modell von künstlicher Intelligenz, das die Simulation und damit Ersetzung der menschlichen Hirnfunktionen zum Ziele hatte. Wie immer man sie bewerten mag, muß wohl von einer prinzipiellen Differenz zwischen Mensch und Computer ausgegangen werden. Das bedeutet, daß sich menschliche Funktionen nicht im Verhältnis 1:1 maschinell substituieren lassen. Das Problem, das sich heute stellt, scheint vielmehr in der Frage nach der Schnittstelle zwischen Mensch und Computer zu liegen und in der Frage, wie der Umgang mit der Digitalisierung die Wahrnehmungs- und Reflexionsformen des Menschen selbst beeinflußt und strukturiert.
Das gleichsam noch von der romantischen Vorstellung einer direkten Affektion des Menschen durch die Maschine beeinflußte Modell dieser Schnittstelle ist der von David Bolter skizzierte „Turingsche Mensch“. Abgeleitet von Alan Turings grundlegenden theoretischen Überlegungen zur Möglichkeit kybernetischer Maschinen, an deren Ende die Ununterscheidbarkeit von menschlichem Bewußtsein und maschineller Informationsverarbeitung stehen sollte, bezeichnet Bolter damit das durch den Umgang mit Computern eingeleitete maschinelle Selbstverständnis des Menschen. Die Pointe des Turingschen Menschen besteht dabei darin, daß nicht der Computer wie ein Mensch werden soll, sondern der Mensch sich als Computer begreift – und Bolter setzt fragend hinzu: „Warum sollte uns dies mehr abschrecken als die kartesianische Vorstellung vom Menschen als Uhrwerk oder der alte Glaube, er sei ein durch göttlichen Hauch belebtes Tongefäß?“ Wenngleich es stimmt, daß die Selbstdeutung des Menschen von den Produkten seiner Tätigkeit [S. 177] nicht unabhängig ist, reicht diese Wendung nicht, um – wie Bolter es möchte – als Philosophie des Computer-Zeitalters reüssieren zu können. Ein Ansatz, der den Computer-Menschen sucht, scheint die Bedeutung der Digitalisierung für das medial vermittelte Bewußtsein zu verfehlen. Erst wenn der binäre Code, dessen kulturell gravierendste Eigenschaft seine Universalisierbarkeit ist – die Rückführung aller Wahrnehmungsreize und aller logischen Kombinationen auf den Dual 0/1 –, als Prinzip einer Medientechnologie begriffen wird, die sich vor der Folie der tradierten Medien unserer Kulturen entfaltet, wird man der dadurch induzierten Transformation unserer Bewußtseins- und Wahrnehmungsformen gerecht werden. Es ist zum Beispiel, paradox genug, daß der Literaturwissenschafter Friedrich A. Kittler dies versuchte und in letzter Zeit mit der daraus abgeleiteten provokanten These vom bevorstehenden Ende der Buch- und Lesekultur auf sich aufmerksam machte.
Geschult am französischen Neostrukturalismus und im nahezu klassischen Sinn belesen, zeichnet Kittler in seinen Publikationen den Weg nach, den die Speicherung und Verarbeitung von Informationen in den letzten zwei Jahrhunderten genommen hat: Von der Handschrift und dem Buch über die Schreibmaschine, Film und Grammophon zum Typewriter und Computer. Eine zentrale These Kittlers ist dabei die, daß sich Medium und Botschaft, Information und ihre zugehörige Übertragungs- und Speichertechnologie nicht voneinander trennen lassen. Neue Informationstechnologien transportieren nie alte Inhalte auf neue Weise, sondern konstituieren immer ihre eigenen Inhalte und Bedeutungen: „Ein Medium ist ein Medium ist ein Medium. Es kann also nicht übersetzt werden. Botschaften von Medium zu Medium tragen heißt immer schon: sie anderen Standards und Materialitäten unterstellen.“ Eine spezifische Form von Sinn oder Bedeutung, wie sie durch das Buch, die gedruckte Schrift, [S. 178] transportiert und aufbewahrt werden kann, muß sich bei der Verwendung anderer Medien verlieren.
Der notwendige Verlust an Schrift- und Lesekultur, der mit der umfassenden Automatisierung, dann Digitalisierung von Information auftritt, wird von Kulturpessimisten gewöhnlich beklagt. Kittler klagt nicht, er beschreibt und deutet den Stellenwert von Informationsmedien und ihren Wandel. An zwei markanten Zeitpunkten – 1800 und 1900 – untersucht er zum Beispiel die relevanten medialen Verarbeitungsformen. Seine These: Um 1800 stand eine umfassende Alphabetisierung auf der Tagesordnung, die die einstige Kunst des Schreibens und Lesens – wenn man so will: Kalligraphie und Hermeneutik – vollkommen und für alle automatisierte. „Das europäische Mittelalter kannte den Extremfall von Schreibern, die als reine Kopisten und Kalligraphen nicht lesen können mußten, was sie auf manuellem Wege vervielfältigten: den Diskurs des Herrn. Es kannte umgekehrt den Extremfall von Lesern, die ihre eigenen Kommentare oder Fortsetzungen von Texten einem Schreiber diktieren mußten. Das Aufschreibesystem von 1800 ist das gerade Gegenteil: eine Kultur, die Lesen und Schreiben automatisiert und koppelt. Zweck dieser Koppelung ist die allgemeine Bildung, Voraussetzung einer Alphabetisierung, die Lesen und Schreiben durch beider Rückbindung an ein einzigartiges Hören verschaltet.“
Die Welt, die sich aus diesem Kreislauf von Schreiben-Lesen-Schreiben konstituiert, ist primär die der Dichtung: „Im Aufschreibesystem von 1800 wird das Buch der Dichtung zum ersten Medium im modernen Sinn.“ Ihre zugehörige soziale Struktur ist die Kleinfamilie, ihre Multiplikatoren sind die Gebildeten und die Geisteswissenschaft, ihr Gewährsmann ist Goethe, ihr letzter Propagandist Hofmannsthal, ihr erster Zerstörer Nietzsche. Abgelöst wird die Dichtung durch die neuen Technologien, ihre Aufschreibesysteme werden [S. 179] durch eine ganz andere Form von Automaten ersetzt: Film, Grammophon und Typewriter. Deren Siegeszug beginnt um 1900: „Die technischen Medien Grammophon und Film speichern akustische und optische Daten seriell und mit übermenschlicher Zeitachsen-Präzision. Zur selben Zeit und von denselben Ingenieuren erfunden, attackieren sie an zwei Fronten zugleich ein Monopol, das die allgemeine Alphabetisierung, aber auch erst sie, dem Buch zugespielt hat: das Monopol auf Speicherung serieller Daten. Um 1900 wird die Ersatzsinnlichkeit Dichtung ersetzbar, natürlich nicht durch irgendeine Natur, sondern durch Techniken.“
Die moderne Digitalisierung aller Daten, die deren unendlichen Fluß ermöglicht, vollendet diese Tendenz. Kultur als Produktion von literatem Sinn hört auf – was bleibt, sind die digitalisierten Spuren jener funktionalen Äquivalente, die einmal menschliche Tätigkeit genannt wurden. Schon der Phonogaph hatte diese Tendenz eingeleitet: „Tod des Menschen und Spurensicherung der Körper sind eins ... Ein auf Schallrillen verewigter Lyriker geht nicht ins Pantheon, sondern in die Archive der neuen Aussagepsychologie ein.“ Dort, wo früher Sinn und Bedeutung produziert wurden, werden heute unendlich viele Daten archiviert. Hieß Lesen früher, diesen Sinn nachzuschaffen, so heißt es heute: Zugriffsmöglichkeit auf Daten gewinnen. Die Tätigkeit des Lesekopfes im Festplattenlaufwerk eines Computers wird vielleicht zum Paradigma zeitgemäßen Lesens werden.
Noch gravierender werden diese Entwicklungen auf die alten Kulturtechniken des Schreibens und Rechnens sein. Dem mittelalterlichen Bild des Kalligraphen, der nicht lesen konnte, was er schrieb, könnte der moderne Typus des Users entsprechen, der nicht mehr schreiben kann, was er liest. Verdrängt schon die allgegenwärtige Tastatur die Handschrift, so wird das Schreiben schlechthin, wenn die Entwicklung von Sprach- und Texterkennungssystemen eine praktikable [S. 180] Schwelle überschritten hat, zu einer antiquierten Tätigkeit werden müssen. In naher Zukunft werden vorliegende Texte nicht mehr abgeschrieben, sondern in der Regel mit dem Scanner „eingelesen“ werden, eigene aber dem Computer diktiert werden, der imstande sein wird, die Laute annähernd fehlerlos in seinen binären Code zu übersetzen und damit der digitalen Welt zuzuführen. Abgesehen von den sozialpolitischen Auswirkungen dieser Perspektive muß man sich vergegenwärtigen, was das Verschwinden einer 5000 Jahre alten Kulturtechnik für die Weltzivilisation bedeuten muß.
Von der Technik des Schreibens wieder getrennt, wird das Lesen im Zeitalter der digitalisierten Kommunikation zwar nicht verschwinden. Aber es wird seine Gestalt grundlegend verändern. Das Durchblättern von Textdateien mit Hilfe eines Suchprogramms am Computerbildschirm ist zwar keine Form des Analphabetismus, aber auch nicht zu vergleichen mit der Lektüre eines Buches, schon gar nicht mit der Deklamation eines poetischen Textes. Und der Student, der sich mit seinem Personal-Computer in die Datenbanken der Universitäten einklinkt, um auf dem Stand der Forschung zu bleiben, ist zweifellos in einer ganz anderen Situation als derjenige, der eine Bibliothek aufsucht. Die Tendenz zur multimedialen Aufbereitung von Informationen, virtuelle Bild-Ton-Text-Kombinationen, die über Datennetze oder CD-ROMs interaktiv mit dem Benutzer kommunizieren, deutet an, daß sich mit einer rasant evolvierenden Technik auch die soziale Struktur unserer Informationsgewinnung und -verarbeitung radikal ändern wird. Der Umgang mit diesen Neuen Medien wird andere Formen der Rezeption erfordern, die es ermöglichen, die Vielgestaltigkeit des Angebots und seine digitale Universalisierbarkeit sinnvoll zu nutzen. Fraglos wird die Zunahme der Geschwindigkeit, mit der sich Zeichen und Zeichensysteme nun präsentieren, zu einer neuen Qualität einer multiplen, aber zerstreuten Wahrnehmung [S. 181] führen. Lesen wird in deren Rahmen nur noch ein integrales Moment darstellen, das auch deshalb auf das technisch notwendige Minimum – schnelles Erfassen von Worten und Wortgruppen – reduziert werden wird. Die Kunst, komplexe Satzperioden zu formulieren und dann sinnvoll akzentuierend laut vorzulesen, wird in naher Zukunft jenen Stellenwert haben, den die Kalligraphie heute hat. Daß mit diesen Wandlungen auch unsere Sprache sich verändern wird, steht außer Zweifel. Die Tendenzen sind schon spürbar. Sie wird knapper, reduzierter, dort, wo die Logik der Maschine es verlangt, genauer, aber auch bilderlos werden. Das, was man einstens Stil nannte, wird verschwinden. Gewonnen kann dadurch eine Dichte und Ausdehnung der Kommunikation werden, wie sie in der Geschichte wohl einmalig genannt werden muß.
Restringiert wird die Technik des Lesens aber auch durch die Omnipräsenz des Bildes, die durch digitale Medien erreicht werden kann. Die rasant zunehmende Möglichkeit, verschiedenste Vorgänge über das Hantieren mit Bildsymbolen zu steuern, läßt Ansätze zu einer Rückentwicklung unserer Schrift in eine Bilderschrift erkennen. Nicht mehr linear verbundene Lautzeichen, sondern graphische Symbole dominieren schon heute die Benutzeroberflächen der Computer, die Leitsysteme in Städten, die Knotenpunkte der Information, die Erscheinungsform der Zeitungen.
Eine digitale Bildkultur, auf die wir zusteuern, wird damit aber die für die abendländische Kultur essentielle Differenz von Zeichen und Bedeutung, die in der Schrift zum Ausdruck kommt, nivellieren. Das Bild suggeriert zumindest, daß Zeichen und Bedeutung in ihm zusammenfallen. Es bedeutet, was es ist. Seine Faszination liegt in dieser unmittelbaren Rezipierbarkeit. Wer Augen hat, der sieht. Daß Kinder in naher Zukunft früher mit einem Ikon-gesteuerten Computer umgehen werden als daß sie lesen lernen, verurteilt letzteres [S. 182] zu einer Zusatzqualifikation, die den Charakter einer Welterschließungskraft verloren hat. Daß Bilder ihrerseits mehr bedeuten können als auf den ersten Blick zu sehen ist, daß sie ihrerseits entziffert und gedeutet werden können, zehrt schon von der Idee der Schrift, lebt von der Idee des Zeichens, das über das Sichtbare hinaus noch eine semantische Dimension in sich birgt. Das Lesen von Bildern verhält sich zum Bild selbst aber wie ein Metadiskurs, der nicht unbedingt notwendig ist – man kann auch ohne cineastische Reflexionen über die Filmsprache eines Regisseurs ins Kino gehen. Ohne lesen zu können, kann man aber nicht lesen. Der Schrift gegenüber ist das Lesen die einzig adäquate Rezeptionsform.
Solcher Befund kann für die Idee der Kultur nicht ohne Belang sein – war diese doch bisher gekoppelt genau an jene Schreib- und Lesetechnik, die durch die zunehmende Digitalisierung in Frage gestellt werden könnte. Kultur, Bildung, so insistierten ihre Verteidiger, ist ja gerade nicht das Sammeln und Verarbeiten von Daten, sondern die Fähigkeit, Sinn und Bedeutung zu produzieren und in Zusammenhängen denken zu können. Solche Kompetenzen aber schienen bisher an das Medium der Schrift, an das Buch gebunden zu sein. Die Idee der Bildung war nicht umsonst Produkt jener Geisteswissenschaft, deren letzter Sinn die Produktion von Sinn sein sollte. Womit sich die Geisteswissenschaft, welcher Abteilung auch immer, beschäftigt, ist vorerst das pure Gegenteil von Daten. Ihre Arbeit ist narrativ und hermeneutisch, nicht archivierend, selektierend oder verknüpfend. Die Digitalisierung des an den Geisteswissenschaften orientierten Bildungswesens wird deshalb einen neuen Typ von Wissenschaft und Bildung kreieren müssen. In Ansätzen ist dieser schon spürbar.
An einem kulturellen Segment, der Tätigkeit der Geisteswissenschaften, können erste Auswirkungen der Digitalisierung [S. 183] des Wissens paradigmatisch beobachtet werden. Unangefochtene Triumphe feiert die Digitalisierung der Wissenschaften natürlich dort, wo es etwas zu selektieren und verwalten gibt: Bücher, Aufsätze, Rezensionen, Titel, Erscheinungsjahre, ISBN-Nummern. Die Bibliographie als Datenbank, das Bibliographieren als Nutzen von Datenbanken scheint in der Tat nur die technische Erleichterung einer gleichermaßen notwendigen wie ungeliebten Arbeit. Wer begrüßt nicht die Umstellung von großen Bibliotheken auf EDV, wer freut sich nicht auf den Zeitpunkt, wo er von seinem privaten PC aus mit jeder universitären Datenbank überall in der Welt kommunizieren wird können und der Computer auf Knopfdruck zu jedem Thema und zu jeder Themenkombination die vollständige Bibliographie auswerfen wird. Allein, Vollständigkeit – philosophisch formuliert: der Anspruch auf Totalität – brachte den Geist noch immer in Probleme. Die universelle Verfügbarkeit von Titeln macht die Bibliographien zwar länger und umfassender, aber gleichzeitig nichtssagender. War intensives Bibliographieren bis vor kurzem auch ein Nachweis für Geschick und Fleiß eines Forschers, wird die vollkommene Bibliographie jetzt zum Standard. Entwertet wird dadurch auf der einen Seite eine Arbeit, auf der anderen vermehrt sie nicht, sondern vermindert die Information: konnte man früher schon aus der Bibliographie einer Arbeit Rückschlüsse über deren Gewicht und Akzentuierung machen – gerade weil sie nicht vollständig war – so bedeutet Vollständigkeit der Information auch hier wie überall Bedeutungslosigkeit.
Ihren Sinn ergeben vollständige Bibliographien erst dann, wenn sie in sich weitere Kriterien enthalten, durch die sie sich benutzen lassen: Verweise auf Zentralbegriffe, Kurzinformationen, knappe Inhaltsangaben. Aufsätze und Bücher können bibliographisch sinnvoll erst dann zu Daten verarbeitet werden, wenn sie zu verarbeitbaren Daten geworden sind. [S. 184] Und sie werden dies, wenn sie zumindest zwei Kennzeichen aufweisen: Keywords und Abstracts. Mit dem zunehmenden Zwang, Publikationen mit Schlüsselbegriffen und Zusammenfassungen auszustatten, verschwindet aber, bei allen Vorteilen dieser Verfahren, ein Stück des Geistes. Denn wissenschaftliche Texte haben von nun an zwei Kriterien zu gehorchen: sie müssen aufs knappste referierbar und mit Zentralkategorien kompatibel sein. Jedes Denken aber, das sich der Eigendynamik fließender Begriffe überläßt, das im Wortsinn reflektierend ist, dem eine Einheit von Sinn und Form inhärent ist, wird genau diese Kriterien nicht erfüllen wollen und können.
Die Parameter, nach denen am PC mit Texten umgegangen wird – Suchen, Umstellen, Einfügen, Löschen, Zusammenhängen – provozieren so überhaupt eine neue Art des wissenschaftlichen Schreibens: das in kleinen, leicht wiederauffindbaren und beliebig miteinander kombinierbaren, mit unendlichen Zitaten angereicherten und auf Schlüsselworte referierbaren Einheiten. Die Verwaltung von Texten und Zitaten wird zu einer originären Produktionsform von Texten. Möglich, daß die Digitalisierung der Wissenschaften dabei auch neue Formen eines kombinatorischen, vielleicht sogar assoziierenden Denkens forcieren kann: Hypertext. Ein Typus geisteswissenschaftlicher Arbeit, nämlich das genaue, bewußt formulierte, sich ständig bewegende Denken, bei dem der Gang der Argumentation selbst zählt und nicht das fixe Ergebnis, wird selten werden; verschwinden wird es nicht.
Man mag es bedauern, aber man wird es einsehen müssen: Lesen und Schreiben in einer avancierten Form – als Produktions- und Rezeptionsweisen von Sinnzusammenhängen und Sinnzuschreibungen – wird zu einer Sache von Minderheiten werden. Aber das kann auch Vorteile haben. Und was Hans Magnus Enzensberger in seinem Lob des Analphabetismus mit Witz, aber ohne Beschönigung für die Literatur formulierte [S. 185], gilt wohl auch für die Geisteswissenschaften: „Der Sieg des sekundären Analphabetismus kann die Literatur nur radikalisieren: er führt einen Zustand herbei, in dem nur noch freiwillig gelesen wird.“ Umformuliert hieße das: Die Digitalisierung der Geisteswissenschaften kann den Geist nur radikalisieren. Sie führt einen Zustand herbei, in dem nur noch freiwillig gedacht wird. Alle anderen hängen Zitat an Zitat und überlassen die files den Netzen oder Massenspeichern. Was entstehen wird, ist eine zweigeteilte Wissenschaftswelt: Auf der einen Seite werden immer dürftiger werdende Kongreßpapers in immer kürzerer Zeit über immer größere Entfernungen immer schneller zirkulieren und dabei immer rasender an Bedeutung verlieren, auf der anderen Seite werden immer weniger Köpfe jene immer seltener werdenden Bücher, die deshalb immer bedeutender werden, schreiben und lesen. Endlich wird der Geist das werden, was marktorientierte Geisteswissenschafter aus eher unedlen Motiven immer schon gerne gehabt hätten: ein knappes Gut.
Mutatis mutandis gilt solches aber für die Idee und Konstitution von Bildung und Ausbildung überhaupt. Die immer wieder thematisierte Spannung zwischen Wissen und Bildung wird unter dem Aspekt der universalen Verfügbarkeit des Wissens neu akzentuiert werden müssen. Die Differenz zwischen dem Zugang zu einer Datenbank und der Kompetenz, diese auch zu benutzen, wird den Umgang mit Informationen prägen. Als zentrales Bildungsziel könnte man so etwas wie eine Hermeneutik der Datenbank konstituieren. Die Befähigung dazu wird die neue Kulturtechnik sein – und es wird mehr dazu gehören, als die Beherrschung eines Computers und seiner Möglichkeiten. Zu fragen wäre dabei sowohl nach jenen zur Ausstattung des Subjekts gehörenden Fähigkeiten, die den selektiven Gebrauch einer unüberschaubaren Datenmenge erlauben, als auch nach der Struktur des Wissens, das in einer Datenbank gespeichert ist. Für die traditionellen Bildungsinstitutionen [S. 186] unserer Kultur, Schulen und Universitäten, wird dies langfristig gravierende Folgen haben – nicht nur was die Ausrichtung der Lehr- und Studienpläne betrifft, sondern vor allem was deren Organisationsform betrifft.
Im Banne des unmittelbaren Umgangs mit dem Computer wird das eigentliche Problem seines flächendeckenden Einsatzes nämlich völlig übersehen: daß die digitale Informationstechnik einen Angriff auf die Idee organisierter Bildung selbst darstellt. Gerade die Universalität der Digitalisierung muß zu einem fundamentalen Dezentralisierungsschub aller Informationsprozesse führen. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum jemand, um Informationen aus einem Datennetz zu bekommen, einen schulischen oder universitären oder betrieblichen EDV-Raum aufsuchen muß, wenn dies vom heimischen PC aus genauso möglich ist. Gerade die Computer-Kultur der Minderjährigen zeigt eindringlich, daß sich der Umgang mit den Neuen Medien jenseits der Institutionen in autonomen Prozessen zu organisieren verstand. Nichts demonstriert die Überflüssigkeit von Schule in diesem Zusammenhang besser als die Tatsache, daß sich fast jeder in einem Schnellkurs unzulänglich ausgebildete Informatiklehrer Schülern gegenübersieht, die auf dem Gebiet, das sie lernen sollen, längst Experten sind. Der rasende Fluß der Daten macht die Aufteilung der Lebenszeit in Lern- und Arbeitszeiten überhaupt zunehmend fragwürdig. Eine Strukturreform der Bildungsorganisation wird zweifellos nach einer Form suchen müssen, die vor allem eines zu sein hat: flexibel. Flexibel aber ist man dann, wenn man von einer gesicherten Basis aus operieren kann – nicht, wenn man aus Angst, den Anschluß zu verpassen, ohne Bedacht aus jeder neuen Technologie ein Studium und aus jeder sozialen Mode ein Unterrichtsprinzip macht. Kern solcher wirklichen Flexibilität aber könnte – so paradox es klingen mag – jene Kompetenz sein, die ein Verstehen und damit Aktualisieren der Datenflüsse – [S. 187] nicht deren maschinengestützte Handhabung, die selbstverständlich werden wird – überhaupt erst ermöglicht: Bildung im klassischen Sinn. Nicht die Akkumulation von Wissen wird entscheidend sein, sondern die Fähigkeit, Daten mit Hilfe eines Koordinatensystems zu selektieren und in entscheidungsrelevante Informationen zu transformieren. Die Konstruktion dieses Koordinatensystems wäre vielleicht als zukünftige Aufgabe der Bildungstheorie zu beschreiben, seine Konstitution womöglich die eigentliche Herausforderung und Aufgabe des Bildungssystems. Zu vermuten ist, daß ein philosophisch fundiertes Rahmen- und Prinzipienwissen, das zum Erstaunen aller an die Humboldtsche Idee der Allgemeinbildung anschließen könnte, am ehesten die Funktion solch eines Koordinatensystems erfüllen wird können. Eine zukunftsorientierte Bildungspolitik hätte etwa statt des immer den Entwicklungen hinterherhinkenden Informatikunterrichts den Philosophieunterricht zu forcieren – Philosophie wohlverstanden als Wissenschaft von den Bedingungen und Prinzipien des Wissens und seines Transfers in der Gesellschaft, nicht als Meinungsaustausch über private Sorgen und Nöte, die zu existentiellen Fragen stilisiert werden. Gelingt diese Transformation des Bildungswesens nicht, wird jener Zerfall der Gesellschaft in Menschen, die ohnmächtig an ihren Monitoren hängen, und in jene dann im Wildwuchs sich konstituierenden Eliten, die die Selektionskriterien für Daten nach welchen Gesichtspunkten auch immer monopolisieren werden, unaufhaltsam sein. Nicht nur Geist, auch Bildung würde zu einem knappen Gut werden.
Die eigentliche Herausforderung der neuen Medien aber entzieht sich wahrscheinlich ohnehin von selbst dem Zugriff organisierter Bildungs- und Kulturpolitik. Entscheidend am Prozeß der Digitalisierung ist nämlich, daß die digital fließende Information äquivalent ist zu jeder möglichen Rekombination oder Konstruktion von Daten. Die durch die [S. 188] neuen Medien vermittelte Wahrnehmung sieht auf den Bildschirmen etwas von der Welt, das sich in nichts von einer künstlich erzeugten Bildschirmwelt unterscheidet. Als entscheidendes Paradigma der Digitalisierung dürfte sich also weniger die Simulation des Menschen als vielmehr die Erzeugung alternativer virtueller Welten erweisen. Über den ontologisch zweideutigen Charakter des elektronisch erzeugten Bildes – es oszilliert zwischen An- und Abwesenheit – hatte schon frühzeitig Günther Anders unter dem Titel Die Welt als Phantom und Matrize Auskunft gegeben; die durch Digitalisierung ermöglichte Produktion virtueller Welten verschärft dieses Problem gravierend; es stellt dies gleichsam die technisch durchgeführte Dekonstruktion des für den europäischen Bildungsgedanken fundamentalen Subjekt-Objekt-Verhältnisses dar. In dem Maße, in dem die Realität und das technisch induzierte Imaginäre tendenziell ununterscheidbar werden, verliert das Subjekt eine seiner wesentlichen Konstitutionsbedingungen: das Weltverhältnis. Unter dem Stichwort „Digitaler Schein“ hat Vilem Flusser dies zugespitzt formuliert: „Entweder sind die alternativen Welten ebenso real wie die gegebene oder die gegebene ist ebenso gespenstisch wie die alternativen.“
Das bedeutet nicht unbedingt, daß das Subjekt sich gleich auflösen wird; das bedeutet aber, daß durch Realitätserfahrung vermittelte Subjektserfahrung eine andere Qualität bekommen wird. Sie wird sich vor der Folie der Erfahrungsmöglichkeiten virtueller Welten, denen eine eigene Qualität schwer abzusprechen sein wird, neu konstituieren müssen. Unmittelbare Körper- und Welterfahrung wird zu einer seltenen und exklusiven Lebensmöglichkeit werden, die ihr Kriterium an der Katastrophe finden wird: einzig die Tatsache, daß er tatsächlich abgeschossen werden kann, bewahrte den Bomberpiloten über Bagdad davor, die Daten seines Bordmonitors mit dem Programm eines Simulationsspieles zu [S. 189] verwechseln. Anders als die Existentialisten es wollten und jenseits aller Bildungstheorien, die zu autonomen Subjekten erziehen wollten, wird die Gefährdung zur entscheidenden Kategorie der Realitätserfahrung und Subjektskonstitution der Zukunft werden.
(Wortwahl, Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung entsprechen dem Original. Hervorhebungen im Original durch Kursivdruck werden gleichfalls durch kursive Schrift wiedergegeben. Offensichtliche Druckfehler wurden berichtigt. Die Seitenzahlen in eckigen Klammern bezeichnen den Beginn der jeweiligen Seite des Originals.)