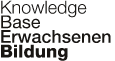Theater für alle? Zwischen Kulturpopularisierung und Kolonialisierung kultureller Lebenswelten
Titelvollanzeige
| Autor/in: | Dostal, Thomas |
|---|---|
| Titel: | Theater für alle? Zwischen Kulturpopularisierung und Kolonialisierung kultureller Lebenswelten |
| Jahr: | 2005 |
| Quelle: | Brugger, Elisabeth/Weber, Frank Michael (Hrsg.): Lessing siegt am Stadtrand. 50 Jahre Volkstheater in den Außenbezirken, Wien 2005, S. 43-82. |
1. Popularisierung von Hochkultur: Ein Theater für das Volk?
[S. 43] „Die rechtwinkeligen, netzförmigen Städte (wie Los Angeles etwa) bereiten uns, so sagt man, ein tiefes Unbehagen; sie verletzen in uns eine kinästhetische Empfindung der Stadt, wonach jeder urbane Raum ein Zentrum besitzen muß, in das man gehen und aus dem man zurückkehren kann, einen vollkommenen Ort, von dem man träumt und in Bezug auf den man sich hinwenden und abwenden, mit einem Wort: sich finden kann. Aus einer Reihe von Gründen (historischer, ökonomischer, religiöser, militärischer Art) hat der Westen dies Gesetz nur zu gut verstanden: All seine Städte sind konzentrisch angelegt. In Übereinstimmung mit der Grundströmung westlicher Metaphysik, für die das Zentrum der Ort der Wahrheit ist, sind darüber hinaus jedoch die Zentren unserer Städte durch Fülle gekennzeichnet: An diesem ausgezeichneten Ort sammeln und verdichten sich sämtliche Werte der Zivilisation: die Spiritualität (mit den Kirchen), die Macht (mit den Büros), das Geld (mit den Banken), die Ware (mit den Kaufhäusern), die Sprache (mit den Agoren: den Cafés und Promenaden): Ins Zentrum gehen, heißt die soziale ,Wahrheit‛ treffen, heißt an der großartigen Fülle der ,Realität‛ teilhaben.“1
Wie in vielen anderen Städten Europas auch, galt und gilt diese Zentrumsfokussiertheit mit ihren konzentrischen Abstufungen politischer, sozialer und kultureller Werte zu Lasten der Peripherie auch für Wien. Der innere „Kern“ der Stadt, der spätere I. Bezirk, war spätestens seit dem Barock die Stadt des kaiserlichen Hofes und des hohen Adels mit seinen Palais und Stadtresidenzen. Mit der unter Kaiser Franz Joseph I. 1857 angeordneten Stadterweiterung sprengte die barockisierte mittelalterliche [S. 44] Stadt ihren einengenden Mauernkranz, an dessen Stelle sich die neu zu gestaltende Ringstraße als Repräsentationsort des liberalen Bürgertums mit seinen Insignien – Rathaus, Universität, Parlament, Museen und Theatern – ausbreitete. Neben der kaiserlichen Residenz, der Hofburg, manifestierte sich die Macht des Kaisers auf der Ringstraße in diversen Kasernen, in seiner k. k. Hofoper und im k. k. Hofburgtheater repräsentierte sie sich kulturell. Das 1888 eröffnete neue Burgtheater war aber im Gegensatz zum alten Burgtheater am Michaelerplatz nun nicht mehr der exklusive Ort des Kaisers und des Hofadels, sondern auch des ökonomisch und sozial aufgestiegenen Großbürgertums.
Diese kulturellen Partizipationsrechte im Theater des Kaisers schienen dem ab der „Gründerzeit“ gesellschaftlich relevant gewordenen Wirtschafts-und Finanzbürgertum aber nicht ausreichend. Zeitgleich mit der Errichtung des Burgtheaters baute es sich auf den so genannten Stadterweiterungsgründen, und damit noch im großbürgerlichen Einzugsgebiet, ein eigenes Theater, mit vergleichbarer Zuschauerkapazität wie das Theater des Hofes. Das, wie es hieß, „Deutsche Volkstheater“, verkehrstechnisch günstig an der so genannten „Zweierlinie“ am Weghuberpark gelegen, hätte eigentlich auch 1888, im Jahr des 40-jährigen Regierungsjubiläums Kaiser Franz Josephs I., eröffnet werden sollen. Die Bauarbeiten verzögerten jedoch die Eröffnung um ein Jahr. Das Volkstheater war vom „Verein Deutsches Volkstheater“ getragen, in dem das Wirtschafts- und Bildungsbürgertum dominierte. Gleichwohl sollte das neue Theater nicht nur für die „oberen Zehntausend“, sondern für die „unteren Hunderttausend“ geschaffen sein, die auch mit billigeren Eintrittspreisen gelockt wurden. So sollte es sowohl als ein Gegenstück zu den Hoftheatern von Burg und Oper geführt werden als auch ein Verbindungsstück zwischen der Elitenkultur des Adels bzw. des Hofes und der Volkskultur in den Operetten- und Varietéhäusern, Kinos und Kleinstbühnen in den Vorstädten bilden. Demgemäß wurde das Theater am Weghuberpark unter der Direktion von Emmerich von Bukovics (1888-1905) am 14. September 1889 mit einem hochkulturierten Volksstück von Ludwig Anzengruber als programmatischem Auftakt eröffnet.2
[S. 45] Die Theaterneugründungen der 1890er Jahre, das Raimund- und das Kaiserjubiläums-Stadttheater (die spätere Volksoper), lagen im Bereich des nächsten konzentrischen Stadtkreises von Wien: des Gürtels, der die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Vorstädte von den kleinbürgerlichen und proletarischen Vororten trennte. Nach der Eingemeindung der Vororte außerhalb des ehemaligen Linienwalls, der nicht nur eine soziale, sondern auch eine militärische und fiskalpolitische Grenze darstellte, wurde auch mittels Theaterpolitik versucht, einen Bezirk nach dem anderen christlichsozial zu dominieren. Die christlichsoziale Partei unter Karl Lueger, der persönlich an der Gründung des Kaiserjubiläums-Stadttheaters beteiligt war, führte auch theaterpolitisch einen Kulturkampf, mit dem Ziel, nach der politischen, nun auch die kulturelle Hegemonie des Liberalismus zu brechen. Die Theater sollten eine Pflegestätte „deutscher Kunst“ werden, was zwischen 1898 und 1903 auch bedeutete, dass keine jüdischen Autoren, Komponisten und künstlerischen MitarbeiterInnen beschäftigt werden durften.
Die sozialdemokratische Partei setzte im Vergleich dazu das Theater als politisches Instrument erst sehr spät ein. Die Volksbühnenbewegung, die in Berlin große Bedeutung erlangte, konnte in Wien nur mit deutlicher zeitlicher Verzögerung und dann auch nur in einem sehr bescheidenen Rahmen wirken. Erst 1906 wurde von den Sozialdemokraten der Theaterverein „Wiener Freie Volksbühne“ gegründet, der sich an sozialdemokratisch organisierte ArbeiterInnen und Angestellte wandte, um das Verständnis für (bürgerliche Theater-)Kunst im Volk, insbesondere in der Arbeiterklasse, zu wecken und zu fördern.3
Ein Grund für das verspätete Engagement der Sozialdemokratie, ihre Klientel auch theaterpolitisch zu vertreten, lag darin, dass es in Wien vergleichsweise früh Aktionen zur Verbilligung von Theaterkarten gab. So wurden am Volkstheater unter der Direktion von Bukovics Nachmittagsvorstellungen eingeführt, an denen Theaterliebhaber aus ärmeren Schichten und Studenten zu ermäßigten Preisen an Aufführungen aus dem hochkulturellen Klassiker-Repertoire (Goethe, Schiller, Grillparzer, Shakespeare, Lessing, Hebbel, Kleist) Anteil haben konnten.4 Zur weiteren Popularisierung der Klassiker-Vorstellungen führte Bukovics die Donnerstag-Abendaufführungen zu ermäßigten [S. 46] Preisen ein, aus denen unter der Direktion von Weisse (1905-1916) die Montag-Abendaufführungen wurden.5 Freilich wurden am Volkstheater neben Klassikern und der dem Gründungsgedanken des Hauses gemäßen Pflege von Volksstücken (Molière, Nestroy, Raimund, Anzengruber) auch zeitgenössische Stücke gespielt. Hier war es neben Wilde, Hauptmann und Schnitzler vor allem Ibsen, der am Volkstheater auch seine deutschsprachigen Erstaufführungen („Peer Gynt“) erlebte.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem damit verbundenen Ende der Habsburgermonarchie, war auch für die Theaterwelt „die Welt von Gestern“ als eine Zeit bürgerlicher Saturiertheit endgültig vorbei. Die Theater in der Zwischenkriegszeit waren verstärkt gezwungen, Räume und Personal optimal einzusetzen und hatten sich auf möglichst hohe Einnahmen zu konzentrieren. Die Theater wurden so stärker von den „Launen des Publikums“ abhängig, welches zunehmend Unterhaltung und Amüsement forderte, mit deren Befriedigung freilich auch die Konkurrenz des Kinos warb. Wenn sich der Erfolg einer Aufführung nicht rasch einstellte, ließ die Direktion das Stück oft wieder in der Versenkung verschwinden. Die Sommermonate stürzten die Theater auf Grund der schlechten Auslastung regelmäßig in eine Krise. Um diesen Fährnissen zu entgehen, musste auch das Volkstheater auf die Suche nach einem Publikum gehen, mit dem es rechnen konnte. Um die Publikumsströme besser kalkulieren zu können, kam es daher in den 1920er Jahren zur Zusammenarbeit mit den so genannten „Kunststellen“, die damit auch die Funktion eines Kartenbüros übernahmen, wobei die bedeutsamsten die „Sozialdemokratische Kunststelle“ und die „Kunststelle der öffentlichen Angestellten“ waren.6 In der Gewissheit einer fixen Abnahme eines bestimmten Kontingents an Eintrittskarten konnte die Direktion ökonomisch freier agieren und sich künstlerischen Experimenten mutiger zuwenden. Andererseits geriet sie in eine ambivalente Abhängigkeit zu den Kunststellen. So war auch das Verhältnis zwischen der dominierenden, 1919 gegründeten „Sozialdemokratischen Kunststelle“ und der Volkstheaterdirektion keineswegs als friktionsfrei zu bezeichnen: Einmal beschwerte sich die Kunststelle, dass ihre Stückwünsche nicht berücksichtigt werden, ein andermal beschwerte sich die Direktion, dass sie sich als Privattheater nicht [S. 47] für Parteizwecke (und die von diesen gewünschten Stücke) einspannen lassen könne. Das bürgerliche Stammpublikum mokierte sich zuweilen über die weniger elegant gekleideten neuen Zuschauerschichten aus der Arbeiterschaft.7
Um vorhandene TheaterbesucherInnen stärker an das Haus zu binden, wurde darüber hinaus in den 1930er Jahren ein eigenes Abonnement-System aufgebaut. Im Jahr 1934 kam es, bereits unter austrofaschistischen Vorzeichen, zur Theateraktion „Theater der Jugend“, innerhalb der Mittwoch und Samstag nachmittags Jugendvorstellungen angeboten wurden.8 Daneben widmete sich zur gleichen Zeit das von Walter Sorell geleitete „Theater der Volkshochschule“ angesichts der durch die Weltwirtschaftskrise zum Massenphänomen gewordenen Arbeitslosigkeit gezielt auch der Gruppe der Arbeitslosen als Theaterpublikum.9
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde das „Deutsche Volkstheater“ unter der Direktion von Walter Bruno Iltz (1938-1944) in die nationalsozialistische Freizeitorganisation „Kraft durch Freude“ (KdF) der Deutschen Arbeitsfront (DAF) inkorporiert. Damit hatte die KdF erstmals in Wien ein eigenes Theater zur Verfügung, in das mit preisgünstigen Theaterabonnements und der Verteilung von Billigkarten massenhaft breitere Bevölkerungsschichten geschleust wurden. Was man jedoch dort vorfinden konnte war ein NS-Musterspielplan mit Klassikern, Tendenzstücken, deutscher Gegenwartsdramatik und seichten Komödien. Die Generalintendanz von Walter Bruno Iltz machte dem Regime einige Zugeständnisse, um dafür einen gewissen eigenständigen Kurs fahren zu können. Ab 1942 hatte das Volkstheater zusätzlich zum Haupthaus als weitere Spielstätte die „Komödie“ in der Johannesgasse. Aber auch jenseits der Donau in Floridsdorf wurde erstmals ein Gastspielbetrieb des Volkstheaters etabliert. Unter der Direktion Iltz waren bereits spätere Theatergrößen wie Gustav Manker als Bühnenbildner und Leon Epp als Schauspieler engagiert, die in der Nachkriegszeit zu bedeutenden Direktoren des Volkstheaters werden sollten.10
[S. 48] 2. Demokratisierung von Hochkultur: Die Gründung des Volkstheaters in den Außenbezirken 1954
Die kulturpolitische Lage in der unmittelbaren Nachkriegszeit war von einem Klima konservativer Rekonstruktion geprägt, in dem es galt, den nationalsozialistisch diskreditierten Deutschnationalismus durch eine österreichische Kulturnation zu ersetzen. Das Gebäude der österreichischen Kulturnation wurde aus dem Geist einer zweifachen Negation errichtet: einer antideutschen (= antinationalsozialistischen) und einer antikommunistischen. Dieses spezifische „Nationbuilding“ knüpfte an eine „altösterreichische“ musikalische und theaterpolitische Hochkulturpflege von Mozart über Beethoven und Haydn zu Grillparzer und Raimund an, endete in seiner spezifischen politisch-kulturellen Konnotierung jedoch schnell im Austroprovinzialismus.
Eingebettet in ein konservatives gesellschaftskulturelles Klima kam es – nach massiven Anlaufschwierigkeiten in der unmittelbaren Nachkriegszeit – bereits innerhalb weniger Jahre zu einer kontinuierlichen ökonomischen und lebensweltlichen Resurrektion: Die nach den Hungerjahren folgende Esswelle (1947-1948) wurde von einer Bekleidungs- (1949-1951) und Möblierungswelle (ab 1950) abgelöst. Ab 1954 war ein allgemeiner wirtschaftlicher Aufschwung auch in breiten Bevölkerungsschichten deutlich spürbar. Der ökonomische Wiederaufstieg beförderte den hochkulturellen Wiederaufbau. 1955, dem Jahr der Wiedererlangung staatsrechtlicher Souveränität, kam es mit der symbolträchtigen Wiedereröffnung von Staatsoper und Burgtheater, mit denen die Wiedererlangung der kulturellen Identität dokumentiert werden konnte, zu einem Aufschwung im Theaterbesuch. Auf Grund der Publikumsprägung durch den Nationalsozialismus mit seiner Vorstellung von kultureller „Entartung“ bestand in der unmittelbaren Nachkriegszeit ein hoher kultureller Nachholbedarf. Vieles gemäßigt Moderne war neu und galt als spektakulär.
In den Tempeln der österreichischen Hochkultur wurden freilich ohnedies primär die Klassiker zelebriert. Die elitäre, hochkulturell ausgerichtete staatliche Kulturpolitik konnte und wollte den betont konventionellen Konsensrahmen nicht verlassen. Dass sich die Klassiker auch im Sinne einer kritischen Moderne inszenieren ließen, zeigten damals freilich die Nestroy-Aufführungen [S. 49] am „Neuen Theater in der Skala“, das jedoch aus politischen Gründen finanziell ausgehungert wurde und 1956 schließen musste. Die Bühne wurde von Politik und journalistischer Öffentlichkeit als „kommunistisch dominiert“ diffamiert. Ihre Regisseure, SchauspielerInnen waren politisch geächtet. Die erst viel später anerkannte künstlerische Qualität galt im Vergleich dazu wenig.11
Denn in der Zeit des bald nach 1945 einsetzenden Kalten Krieges herrschte, flankiert von der gesellschaftskulturell und bewusstseinspolitisch prägenden US-amerikanischen Besatzungsmacht (Stichwort: „Coca-Colonisation“), auch auf dem Feld der Theaterpolitik ein forcierter Antikommunismus, der systemstabilisierend und systemintegrierend wirkte.12 Überall witterte die Provinzpresse „kommunistische Unterminierung und Infiltrierung“. In Wien waren die beiden einflussreichen Theaterkritiker Hans Weigel und Friedrich Torberg federführend an der Aufführungsblockade von Theaterstücken Bertolt Brechts beteiligt. Brecht wurde quasi ein theaterpolitisches Opfer des Kalten Krieges. Auf Grund der engen Verquickung von Kunst und Politik wurde in Österreich, das geopolitisch am Rande des Eisernen Vorhangs lag, der Kampf um die westlichen Werte auch vor dem Eisernen Vorhang des Theaters ausgetragen. Die diesbezügliche Dramaturgie lautete folgendermaßen: Der Kommunismus ist der Todfeind der Demokratie, Brecht war Kommunist, wer ein Stück des Kommunisten Brecht spielt, arbeitet damit den Kommunisten und Feinden des Westens in die Hände.13 In der kulturpolitisch solcherart aufgeladenen Zeit während des so genannten „Brecht-Boykotts“, der vom Anfang der 1950er Jahre bis zum Jahr 1963 währte, wagte es außer der Scala nur ein Theater in Wien, ein Brecht-Stück in den Spielplan aufzunehmen: 1952 inszenierte das Volkstheater „Die Dreigroschenoper“; freilich als Kompromiss an die Zeitumstände entsprechend entschärft in der Fassung von 1928 ohne die zeitaktuell zugespitzte Neubearbeitung Brechts.14
Aber nicht nur kulturpolitisch, auch kultursoziologisch hatte sich die Großwetterlage am Theater im Vergleich zur Vorkriegszeit beträchtlich verändert. Das Wiener Bildungsbürgertum, die einstige soziale Trägerschicht des Volkstheater, gab es in der historisch bekannten Form nach 1945 kaum mehr. Das [S. 50] jüdisch-liberale assimilierte Bürgertum war zur Emigration gezwungen bzw. von den Nationalsozialisten ermordet worden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es keine breitere Schicht eines freien Unternehmertums, keine Agglomeration großen Privatkapitals mehr, welches den ökonomischen Rückhalt für einen so großen Theaterbetrieb hätte bieten können. Der Klassencharakter des Theaters löste sich auf, was sich auch in den Eigentumsverhältnissen niederschlug.
Nach 1945 musste die schwierige Vermögensrückgabe an die 1934 und 1938 verbotenen und enteigneten Gewerkschaftsorganisationen vorgenommen werden. Dort wo Vermögenswerte nicht mehr vorhanden waren, wurde auf andere Liegenschaften und Ressourcen der DAF zurückgegriffen. Im Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) waren alle ehemaligen Richtungsgewerkschaften zusammengeschlossen, weshalb auch ein Teil der Ansprüche der 1934 verbotenen Freien Gewerkschaften an den ÖGB fiel. Aus der „Erbmasse“ der DAF stand unter anderem das für die KdF-Aktion genutzte Volkstheater zur Disposition. Es wurde dem ÖGB über den Weg des Restitutionsfonds der Freien Gewerkschaften als Ersatz für andere Ansprüche, die nicht mehr zu befriedigen waren, zugeschlagen. Am 26. November 1948 wurde die Volkstheater Ges.m.b.H. gegründet. Ihre Leitung bestand aus einem kaufmännischen und aus einem künstlerischen Direktor sowie aus zwei Gewerkschaftern, dem Finanzreferenten und dem Bildungsreferenten des ÖGB. Damalige Geschäftsführer waren Josef Zak vom ÖGB, Karl Dittrich von der Arbeiterbank (der späteren Bawag) bzw. dem Restitutionsfond und Volkstheater-Direktor Paul Bernay. In den Aufsichtsrat waren neben dem Arbeiterkammer-Präsidenten und Vertretern des ÖGB auch Vertreter der Gemeinde Wien delegiert. Damit war das Volkstheater von SPÖ-nahen Interessenorganisationen dominiert, wobei dieses in der Anfangszeit dementsprechend auch als „Theater des ÖGB“ agierte, später, unter der Direktion Epp, aber durchaus größere künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten gegenüber dem künstlerischen Beirat erhielt.15
Im Jahr 1952 wurde Leon Epp auf Vorschlag des ÖGB-Bildungsreferenten und Geschäftsführers der Volkstheater Ges.m.b.H., Franz Senghofer, zum neuen Direktor des Volkstheaters bestellt. Mit der Direktion Epp vollzog sich nicht nur personell [S. 51] eine Ablöse von der älteren Generation, sondern auch eine inhaltliche.16 Epp fasste den Begriff Volkstheater nicht mehr in einem engen, sozialen oder landschaftlichen Sinn, sondern in einem universalen, wodurch sich dem Volkstheater neue Impulse und Möglichkeiten auftaten.
Die Theaterpolitik Leon Epps bestand aus einer dreifachen Strategie: Erstens sollte das bisherige traditionelle Stammpublikum auch weiterhin mit den Abonnement-Aufführungen bedient werden. Zweitens schuf Epp zwecks innerer, auch publikumssoziologischer Diversifizierung ein neues Sonder-Abonnement, das zunächst „Dichtung der Gegenwart“, ab 1961 „Spiegel der Zeit“ hieß. Das Sonder-Abonnement sollte aktuelle Probleme und neuere Entwicklungen der Zeit theatralisch akzentuiert aufzeigen. Die dritte Strategie bestand in der äußeren, territorialen und sozialen Expansion des Volkstheaters in die Wiener Außenbezirke jenseits des Gürtels und der Donau, wo theaterpolitisch offensiv neue, bisher dem Theaterbetrieb fern stehende Publikumsschichten gewonnen werden sollten.
Diese Konzeption einer Popularisierung des Volkstheaters in den Außenbezirken war ein Kind der 1950er Jahre und perfekt in die damalige kulturpolitische Konstellation eingebettet. Initiiert von ArbeitnehmerInnenvertretern wurde eine spezifische Form eines professionellen, hochkulturierten Vorstadttheaters geschaffen, welches neben den Intentionen einer sozialdemokratisch geprägten Form der Kunstpopularisierung auch volksbildnerische Aufgaben zu erfüllen hatte. Man wollte ein kulturpolitisches Vorzeigemodell einer gelungenen Vermittlung von Theaterhochkultur in dafür bisher publikumsferne Schichten und Gegenden schaffen. Durch die bewusste Lozierung am Wiener Stadtrand wurde versucht, aus dem Bild einer metropolitanen, zentrumsfokussierten Hochkultur herauszutreten.17
Die konkrete Initiative zur Gründung der Theateraktion des Volkstheaters in den Außenbezirken, welche anfänglich „Theatervorstellungen der Wiener Arbeiterkammer für Arbeiter und Angestellte“ hieß, ging nicht vom Volkstheater selbst, sondern, wie die ursprüngliche Bezeichnung schon deutlich macht, von der Arbeiterkammer Wien aus, welche ihre bisherige allgemeine finanzielle Zuwendung an das Volkstheater auf eine ihrem Bildungs- und Kulturauftrag gemäße Form einer gezielten [S. 52] Förderung ihrer zu vertretenden Interessengruppen, den ArbeiterInnen und Angestellten, umstellen wollte. Franz Senghofer, Bildungsreferent des ÖGB und von diesem in die Geschäftsführung des Volkstheaters entsandt, schlug daher die Schaffung und Finanzierung einer Theateraktion vor, die ausschließlich den ArbeitnehmerInnen zugute kommen sollte. Indem man dem Kulturauftrag gemäße und für das Vorstadtpublikum geeignete Stücke des Volkstheaters hinaus in die Arbeiterbezirke zu den Wohnorten der ArbeiterInnen bringen wollte, sollte auch ein bewusster theaterpolitischer Schritt getan werden.18
Am 12. September 1953 wurde der Vorschlag Senghofers vom Vorstand der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien unter Vorsitz ihres Präsidenten Karl Mantler angenommen und beschlossen, künstlerisch wertvolle Aufführungen des Ensembles des Volkstheaters vom Zentrum in die Randbezirke der Stadt hinauszuführen.19
In den folgenden vier Monaten ging man daran, die Idee gemeinsam mit dem Volkstheater, dem Bildungsreferat des ÖGB und dem Kulturamt der Stadt Wien umzusetzen. Die finanziellen Grundlagen wurden gemeinsam mit dem kommerziellen Direktor des Volkstheaters, Heinz Peyerl, gelegt. Zunächst stellte das Kulturamt unter Stadtrat Hans Mandl den Großteil der finanziellen Mittel bereit. Ab der Saison 1956/57 übernahm die Arbeiterkammer fast zur Gänze die Finanzierung. Zur Koordinierung der anlaufenden Arbeiten und zur Kontrolle der Außenbezirksaktion setzte die Arbeiterkammer einen eigenen Theaterausschuss, bestehend aus Vorstandsmitgliedern unter Vorsitz von Andreas Thaler, ein.
In der konkreten künstlerischen Arbeit wurde dem Volkstheater freie Hand gelassen. Die Volkstheater-Dramaturgie hatte gemeinsam mit der jeweiligen Tourneeleitung, die am Beginn in der Hand von Hermann Laforet lag, das Spielprogramm eigenverantwortlich zu erstellen und mit den SchauspielerInnen des Volkstheaters umzusetzen. Freilich hatte es dem Bildungsauftrag der Arbeiterkammer zu entsprechen.
Bezüglich der organisatorischen und logistischen Aufbauarbeiten legte Bildungsreferent Franz Senghofer gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der Arbeiter im Hotel- und [S. 53] Gastgewerbe und Organisator der Volkstheatergemeinde, Fritz Sailer, einen Organisations-, Werbe- und Veranstaltungsplan vor. Man hatte günstig gelegene Vorführungsstätten ausfindig zu machen, mit denen die dafür notwendigen Mietverträge abgeschlossen wurden. Für einige Spielstätten wandte die Arbeiterkammer teils beträchtliche Adaptierungs- und Umbauarbeiten auf.
Die Hauptlast des Kartenvertriebs trug die Kartenstelle des Bildungsreferats des ÖGB unter der Leitung von Berta Sugg. Die Karten wurden zu sehr günstigen Preisen (ein „Volkstheater zu Kinopreisen“, wie es in den Programmzetteln hieß) an die gewerkschaftlichen Bildungsfunktionäre in den Betrieben und Ortsgruppen sowie an die städtischen Büchereien, die ihren Standort in der Nähe einer Spielstätte hatten, verteilt.20 Erst mit der Spielsaison 1997/98 wurde der zentrale Kartenverkauf, der zuvor in der ÖGB-Kartenstelle situiert war, in das Haupthaus des Volkstheaters übersiedelt.
Vom Entstehen der Idee bis zu ihrer Realisierung waren inzwischen lediglich wenige Monate vergangen, als am Abend des 5. Jänner 1954 zum ersten Mal der Vorhang einer Außenbezirksvorstellung, die damals noch unter dem Titel „Das Volkstheater kommt in die Außenbezirke Wiens“ lief, im Franz-Novy-Heim in Stadlau für das Stück „Helden“ von Bernard Shaw hochging.
Theaterkritiker Hans Weigel würdigte diese Initiative zur Theaterpopularisierung retrospektiv: „Wenn es eine Gerechtigkeit der Theatergemeinde gibt, dann wird der 5. Jänner 1954 einst als historischer Tag erster Ordnung mit einer weit über Wien und Österreich hinausreichenden Bedeutung angesehen werden. Da begann nämlich die Aktion der Volkstheatergastspiele in den Außenbezirken mit einer Vorstellung der ,Helden‛ von Bernhard Shaw in Stadlau, und was da begann, begab und begibt sich leider, wenn auch nicht unter Ausschluß, so doch unter weitgehender Teilnahmslosigkeit der Öffentlichkeit.
Das Kulturamt der Stadt Wien und die Arbeiterkammer hatten das Unternehmen begründet; die politisch nahestehenden Blätter hatten pflichtschuldig zugestimmt, die anderen waren pflichtschuldig indifferent geblieben, das vorbildliche Projekt war mit seinen höchst ermutigenden Ergebnissen nicht nur geographisch am Rand verlaufen, die großen Blätter schickten [S. 54] und schicken mit Vorliebe die zweite Garnitur der Referenten zu den Premieren und brachten und bringen jene verwaschenen zustimmenden Berichte, die schlimmer sind als die heftigsten Ablehnungen.
All dieser Indifferenz zum Trotz geschieht in jeder Spielzeit seit jenem historischen Jännertag des Jahres 1954 acht Monate lang Theatergeschichte in den primitiven, behelfsmäßigen, schmucklosen und gar nicht immer für theatralische Darbietungen geeigneten Sälen der Vorstädte und Vororte, in Hernals, Ottakring, Meidling, Favoriten, Simmering, Döbling, Baumgarten, Brigittenau, Breitensee, Floridsdorf, in Schwechat, Liesing, Stadlau, Leopoldau, Jedlesee und Groß-Jedlersdorf; denn ein internationales Vorurteil, genährt von den Fachleuten aller Länder, wird dort acht Monate lang an je zweiundzwanzig Abenden triumphal widerlegt. Gewiß kommt die sogenannte Kultur auch sonst gelegentlich in die Vorstadt und an den Stadtrand, sie kommt in billigster Ausgabe durch mittelmäßige und untermittelmäßige Truppen, Liebhaberbühnen und bunte Abende minderer Sorte. ,Das Volk will es so und nicht anders‛, sagt man, ,die große Kunst ist exklusiv, an Voraussetzungen gebunden, nur für geistig Privilegierte zugänglich‛, sagt man – und rechtfertigt damit die Gottverlassenheit durchschnittlicher Filme, Bücher, Presseerzeugnisse und Radioprogramme. Das Volk aber, das Publikum der Kinos und Leihbibliotheken, das Volk der Radiohörer und Zeitschriftenleser, voraussetzungslos und durchaus nicht vorgebildet, akzeptiert freudig, willig, begeistert und voll Verständnis die gar nicht so primitiven, die durchaus klugen, anspruchsvollen und in ihrer gebundenen, distanzierten Sprache einigermaßen schwer eingängigen Lustspiele von Molière, Kleist und Lessing, die ,Kabale und Liebe‛, den ,Biberpelz‛, wenn sie in ,städtischen‛ Besetzungen dargeboten werden. Die verlogene Parole von der ,volksnahen‛ Kunst wurde hier überraschend beim Wort genommen, indem man die Kunst nicht verwässerte und verfälschte, sondern sie in ihrer Originalgestalt zum Volk schickte. Und das Volk sah, daß es gut war. Das Ergebnis sollte zu denken geben und Schule machen!
Und vielleicht war an jenem 5. Jänner 1954 ein besonderer Augenblick, das ganz besondere Ereignis, das dem Experiment die letzte Bestätigung brachte. Da hatte im dritten Akt der ,Helden‛ [S. 55] Bluntschli zu sagen: ,Mein Rang ist der höchste, den man in der Schweiz anerkennt: ich bin ein freier Bürger.‛ Und die Stadlauer, ohne Tradition und Übung im Besuchen von Theatervorstellungen, applaudierten spontan – sie erfanden sozusagen von sich aus den Szenenapplaus, sie ehrten so nicht nur den Autor und seine Interpreten, sondern auch sich und vor allem die Demokratie, die Shaws Aphorismus feiert und die sie durch ihren Beifall mitvollzogen.“21
3. Theater- und Regiekonzepte im Kontext sozialdemokratischer Kulturpolitik
„Ein anderer Widerstand ist, daß hier in Wien leider alles parteipolitisch gefärbt ist. Es gibt nichts mehr, was nicht irgendwo parteipolitisch eingeordnet wird, so auch das Theater. Es gibt Publikumskreise, die uns als rotausgerichtetes Theater diskriminieren und deswegen unsere Vorstellungen meiden. [...] Wir haben einen politischen Spielplan, [...] aber es hat nie jemand von mir einen parteipolitischen Spielplan verlangt. Wie halten uns von parteipolitischen Dingen völlig fern.“22
So beschrieb Volkstheaterdirektor Leon Epp die in Österreich nicht unverbreitete Angewohnheit, eine politische Haltung gleich mit konkreter Parteipolitik zu verwechseln. Denn Epps Theater war in einem weiteren Sinne eine durchaus politische Angelegenheit. Ihm ging es nicht nur um den Aufbau eines anspruchsvollen Spielplans und um die als „neuer Geist für das alte Haus“ umschriebene Verantwortung den ZuschauerInnen gegenüber, die weder radikal verschreckt noch allzu gefällig bedient werden sollten. Sein Theater sollte ein Ort geistiger Auseinandersetzung mit den existenziellen gesellschaftlichen Problemen der Zeit werden.23 Epps Theater als „moralische Anstalt“ sollte ein aufklärerisches und aufklärendes Theater, ein Theater des Humanismus sein, ein „Theater als Stätte, die mitdienen soll an der Entwicklung der Menschheit“.24
Mit dieser theaterpolitisch emanzipativen Konzeption konnte sich Epp weitgehend mit den Grundsätzen einer sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Kulturpolitik treffen, deren historische Aufgabe es war, einen Beitrag zur kulturellen Emanzipation der Arbeiterschaft zu leisten. Um bisher privilegierte [S. 56] und exklusive Kulturgüter auch den ArbeiterInnenschichten zugänglich zu machen, wurden bürgerliche kulturelle Traditionen und Werte in die Arbeiterklassen transformiert und popularisiert. Ähnlich wie im Feld der Volksbildung, wo ein (bildungs-)bürgerlicher Wissenskanon für breitere außer- und unterbürgerliche Schichten verfügbar gemacht werden sollte, versuchte man auch auf dem Gebiet der Kultur, der Kunst und des Theaters, soziale Barrieren zu überwinden und Zugangsschienen für alle daran Interessierten zu legen. Parallel dazu sollten spezifisch proletarische Kulturformen entwickelt und ausgebildet werden, die zu einer eigenen „sozialistischen Gegenkultur“ gerinnen sollten. Dies führte zwar zu spezifischen Ausformungen einer eigenständigen Arbeiterkultur, aber grosso modo wurden die bereits bestehenden elitenkulturellen Manifestationen einer bürgerlichen Kultur an die ArbeiterInnenschichten vermittelt.
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kam es parallel zum Prozess der sozioökonomischen und gesellschaftspolitischen Integration der Arbeiterklasse in die bürgerliche Nachkriegsgesellschaft und deren damit verbundenen Akkulturierung an (klein-)bürgerliche Wert- und Lebensnormen zu einer zunehmenden Auflösung ihrer klassenspezifischen Arbeiterkultur, welche letztendlich in den großen Strom einer hegemonialen Massen- und Popularkultur einmündete.
Eine sozialdemokratische Kulturpolitik nach 1945 stellte sich demgemäß „die besondere Aufgabe, jenen einen Zugang zu den kulturellen Werten der Gegenwart und der Vergangenheit zu schaffen, bei denen das im Verlauf ihres Bildungswegs versäumt wurde oder die aufgrund ihres Wohnortes, ihrer finanziellen Situation und auch aus Zeitgründen diesen Zugang nur schwer finden können. Das Ziel einer arbeitnehmerorientierten Kulturpolitik bleibt es, auch im Bereich der bildungs- und kulturpolitischen Maßnahmen Prozesse einzuleiten, die es dem einzelnen ermöglichen, im Beruf ebenso wie in der Freizeit, in der Produktion ebenso wie im Konsum, Ausdrucksformen eines kulturellen Verhaltens zu entwickeln, das Individualität ebenso einschließt wie Solidarität.
Das Grundprinzip aller Aktionen, wie das Theater in den Außenbezirken, der Kulturverbund und die Aktion Bundestheater in den Bundesländern, ist es nicht, einfach Kunst zum [S. 57] Konsumieren bereitzuhalten und zu warten, ob sich jemand dafür interessiert oder nicht. Den Menschen muß nachgegangen werden, ihre nicht selbstverschuldete, sondern in der Geschichte und in der Gegenwart unserer Gesellschaft begründete Kunstferne ist durch Annäherung zu überwinden. Das ist die Aufgabe, der sich die Arbeiterkammern im Rahmen ihrer Kulturarbeit stellen.“25
Dieses sozialdemokratische Konzept einer bewussten, geleiteten und (vor-)selektierten Vermittlung von Kunst aus der allgemein akzeptierten (bürgerlichen) Hochkultur an die breiteren Bevölkerungsschichten führte dazu, dass sich das Regiekonzept des Volkstheaters in den Außenbezirken klar von experimentellen, avantgardistischen und subkulturellen Theaterformen abgrenzte. Das von Leon Epp entwickelte „geistige Schema“, nach welchem der Spielplan für die Außenbezirkstournee des Volkstheaters erstellt werden sollte, blieb im Wesentlichen seit seiner Gründung das gleiche: „Wir spielen acht Stücke, jeweils fünfundzwanzigmal. Die Auflage bei der Begründung war im Prinzip: 4 Klassiker, 2 Stücke der Gegenwart und 2 Lustspiele pro Saison. Das konnte in den ersten Jahren auch sehr schön durchgehalten werden. Heute ist das Reservoir der Klassiker jedoch nahezu erschöpft, da wir auf den kleinen Bühnen nur Stücke mit kleiner Besetzung und beschränkter Dekoration aufführen können. So hat sich der Spielplan zugunsten der modernen und heiteren Stücke verschoben.“26
Seit seiner Gründung lag es somit in der Konzeption des Volkstheaters in den Außenbezirken, „bürgerliches Bildungstheater“ an arbeiterliches, und damit zumeist sozialdemokratisch orientiertes Publikum zu vermitteln. Da neben dem Publikum auch der Aufführungsort einen wichtigen Bestandteil einer jeden Aufführung bildet, und dieser sich zumeist in den sozialdemokratisch dominierten Arbeiterbezirken und dort zumeist in der Nähe der von der SPÖ-dominierten Kommunalverwaltung errichteten Gemeindebauten der Vororte und Vorstädte Wiens befindet, kann man beim Volkstheater in den Außenbezirken in einem weiteren Sinne von einem sozialdemokratischen Theater, eingebettet in die spezifische Figuration einer Wiener Kulturpolitik der Nachkriegszeit, sprechen.27
[S. 58] 4. Die Spielstätten an der Peripherie
„Man muß in eine Stadt durch die Vorstädte hineingehen. Die Sprache der Vorstädte ist die Klage: Wir wohnen nirgends mehr, weder draußen noch drinnen. Die Klage darüber, verwaist zu sein, erklang schon mit François Villon in den Vierteln der klassischen Stadt. Sie verbreitete sich bis ins Herz der modernen Metropolen. Der schlechte Sohn, die verlorene Tochter, die Kinder der Zone kommen sonntags ins Zentrum, um ihre Klagelieder zu singen, die weder Hand noch Fuß haben. Sie rezitieren Prosagedichte. Sie bringen die Dichtkunst durcheinander. Sie nennen sich Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. ,Du liest Prospekte, Kataloge, Plakate die lauthals singen / Das ist die Poesie heute morgen und für die Prosa sind die Zeitungen da.‛ So beginnt Apollinaire die Gedichtsammlung Alkohol mit dem Gedicht ,Zone‛. Zone ist das griechische Wort für Gürtel, weder Land noch Stadt, sondern ein anderer Ort, der im Verzeichnis der Wohnstätten, der Situationen, nicht vorkommt.“28
Die Spielstätten des Volkstheaters in den Außenbezirken liegen in vielen Fällen in der „Zone“, in jenen suburbanen Zwischengegenden, wo sich die Stadt auf das Land ausdehnt bzw. wo das Land in die Stadt hineinreicht; Manifestationen der Desintegration einer Stadt, die zugleich auch ein Zeugnis von der „Satellitenhaftigkeit der urbanen Existenz“ ablegen. Diese „Orte der Auslieferung und Austreibung, (diese) deterritorialisierten Orte“ sind, „selbst wenn diese Orte für die Kultur bestimmt sind, [...] keine Orte des Glanzes mehr, sondern Orte der Absorption und der Entleerung, der Flüssigkeitsumwandlung, Input/Output-Maschinen.“29
Traditionell liegen die Stätten der Kultur und des Theaters im Zentrum einer Stadt, an repräsentativen Orten, womit sie auch topographisch den zentralen Stellenwert, den eine Gesellschaft der Theaterkunst zuschreibt, bestätigen. Dies galt, historisch gesehen, auch für Wien. Doch in der Nachkriegszeit setzte die Planung der Stadt bewusst an der Peripherie ein und ging nicht mehr vom Zentrum aus. Das hatte auch partei- und machtpolitische Gründe: 90 Prozent der Bezirke waren sozialdemokratisch regiert, nicht jedoch der bürgerliche I. Bezirk, die Innere Stadt, die konservativ war und blieb. Stadtkulturell gesehen schien man auf der Suche nach einem Experimentiergelände an der [S. 59] Peripherie zu sein, um neue stadtpolitische Konzepte umsetzen zu können.30
In diesen kulturpolitischen Kontext ist auch das Volkstheater in den Außenbezirken einzuordnen. Zunächst expandierte man in den 1950er Jahren in den alten Vororten außerhalb des Gürtels, mit seinen Vereinssälen, Arbeiterheimen, Nebenzimmern in Gasthäusern und Vorstadtkinos. Das Volkstheater in den Außenbezirken hatte zunächst auf solche Räumlichkeiten zurückzugreifen. In der Anfangszeit waren es vor allem die Kinosäle, die traditionellen Fluchtorte des kleinen Vorstadtglücks, die oft selbst umfunktionierte ehemalige Theaterbühnen waren, hinter deren Filmleinwand sich noch immer eine Bühne befand, die nun als neue Spielstätte adaptiert werden konnte. Die Kinosäle eigneten sich freilich nur bedingt für Theateraufführungen. Zwar konnte in den meisten eine Hinterbühne eingerichtet werden, Heizung, Garderoben und Sanitäranlagen stellten jedoch große Probleme dar.31 Neben den Kinosälen wurden Vorstadt-Kasinos sowie sozialdemokratische Arbeiter- und Volksheime als Spielstätten adaptiert.
Über die Vorstädte und Vororte ging das Volkstheater in den Außenbezirken aber auch weiter hinaus in das Umland von Wien: Seit 1954 wurde in Schwechat gespielt, 1957 gastierte man in Eisenstadt, Ebenfurt und Pinkafeld im Burgenland. In Mödling wurde seit 1977 gespielt. Im gleichen Jahr spielte man mit Gastspielen in Eisenstadt, Güssing, Mattersburg und Oberschützen.
Ab den 1960er Jahren ließ die kommunale Wohnbaupolitik der Stadt Wien neue Kerne an der Peripherie entstehen. In Suburbia, den neuen Zwischenstädten,32 wuchsen große Gemeindebausiedlungen. Diese Stadtentflechtung durch den Bau der Stadtrandsiedlungen der 1970er und 1980er Jahre, wie die Großfeldsiedlung, die Siedlung am Rennbahnweg und die Per-Albin-Hansson-Siedlung am Laaerberg, war jedoch von einer Vernachlässigung der Verkehrs- und kulturellen Infrastruktur gekennzeichnet, verbunden mit einem vom urbanistischen Gesichtspunkt aus ungünstigen Verzicht auf eine soziale und altersmäßige Durchmischung der Mieterstruktur. In diesen neu entstandenen Gemeindebausiedlungen wurde nun auch verstärkt das Volkstheater in den Außenbezirken lokalisiert. Der Wiener Gemeindebau stellt eine architektonische Manifestation [S. 60] des sozialdemokratischen Gesellschaftskonzepts einer Verbindung von „Politik, Bildung und Kultur“ dar. Sein Nukleus, Zentrum der meisten großen Gemeindesiedlungen, Ort der sozialen Verdichtung und des nachbarschaftlichen Austauschs, sind die so genannten „Häuser der Begegnung“, die als Mehrzweckräume (Theater-, Konzert-, Kongressraum, Festsaal, Sport- und Ausstellungshalle) der Vermietung für verschiedene Parteiveranstaltungen sowie Veranstaltungen aus dem breiten Feld des Vereinswesens dienen, durch die oft in unmittelbarer Nachbarschaft angesiedelten Volkshochschulen und Städtischen Büchereien aber auch als Stätten der Bildung zur Verfügung stehen. Durch die Anmietung von Sälen der Häuser der Begegnung durch das Volkstheater in den Außenbezirken kam auch noch das kulturelle Feld hinzu. Organisatorisch gehören die Häuser der Begegnung und die Wiener Volkshochschulen zum Verband Wiener Volksbildung, der von der zuständigen Magistratsabteilung der Gemeinde Wien subventioniert wird und damit ebenfalls Teil der Kulturpolitik der Stadt ist. Das Volkstheater in den Außenbezirken überweist die Saalmiete und die Aufwendungen für die Heizkosten für den jeweiligen Vorstellungsabend an die einzelnen Spielstätten. Darüber hinaus erhalten die Volkshochschulen mit der Jahresabrechnung 15 Prozent der Einnahmen der Spielstätte als Entschädigung für den personellen Mehraufwand refundiert.33 Bis heute werden die neu entstandenen Häuser der Begegnung im II., X., XIII., XV., XXI., XXII. und XXIII. Bezirk als Spielstätten des Volkstheaters in den Außenbezirken genutzt. Aber auch in den Häusern der Volkshochschulen selbst wurden Spielstätten der Außenbezirkstournee eingerichtet: in den Volkshochschulen Ottakring, Meidling und Hietzing ebenso wie in Bildungshäusern und Volksheimen, etwa im Volksheim Heiligenstadt. Lediglich fünf Spielstätten werden nicht durch den Verband Wiener Volksbildung verwaltet: die Spielstätte am Laaerberg ist ein Veranstaltungssaal der SPÖ-Bezirkssektion 27 im X. Wiener Gemeindebezirk, die Körnerhalle in Schwechat ist eine große Veranstaltungshalle mit eigener Verwaltung, das Showzentrum Simmering ist Teil eines Einkaufszentrums, die Spielstätte im XII. Bezirk ist ein Veranstaltungssaal in einer Berufsschule und das Theater Akzent ist ein Theatergebäude im Besitz der Arbeiterkammer, welches erst 1989 als letzte Spielstätte eröffnet worden ist.
[S. 61] Die technische Ausstattung der meisten Spielorte ist mit Ausnahme des neuen Theaters Akzent schlecht und für einen modernen Theaterbetrieb unzureichend. Da es nicht möglich ist, jeden Abend in der jeweiligen Spielstätte Ton und Licht abzustimmen, stellen sie eine fixe Größe dar, die freilich je nach Beschaffenheit des jeweiligen Aufführungsraumes eine unterschiedliche Wirkung erzielt. Die SchauspielerInnen haben sich täglich auf die geänderte räumliche Situation einstellen. Die Bühnenbilder sind in der Größe variabel: Zumeist ist eine große und eine kleine Variante des Bühnenbildes vorhanden. Einzelne Elemente der Bühnenwände lassen sich in der Regel verschieben oder entfernen. Auch die Requisiten werden nach Ermessen auf kleineren Bühnen reduziert.34
Dass die kargen Bühnenräume nicht unbedingt einen Nachteil darstellen müssen, spricht die „Grande Dame“ des Volkstheaters in den Außenbezirken, die Schauspielerin Elisabeth Epp, an: „Das barocke oder barockisierende Theater ist natürlich ein außerordentlich zwingender Raum, in dem sie sich wahrscheinlich anders fühlen, als wenn sie in einem kahlen Raum sitzen, wie gerade diese wunderbare VHS Ottakring, mit diesen wunderbaren Sitzen, mit der amphitheatralen Struktur. Heute ist ja eine Art Bühne aufgebaut, das war aber damals noch nicht, es war wirklich kahl, man hat schon ein bißchen angedeutet, Dekorationen und so, aber es hat wirklich nur das Wort gewirkt, das Publikum war nicht abgelenkt. Das hat eine große Rolle gespielt.“35
Trotz der Herausforderung durch die „kargen Räume“ der Mehrzweckhallen und Volksheimsäle in den Vorstädten fanden die Saisoneröffnungspremieren zumeist im Haupthaus statt. Die Folgepremieren der Saison fanden im Festsaal der Zentralberufsschule im XII. Bezirk statt. Erst nach der Fertigstellung des neuen Theaters Akzent, auf dem Areal des abgerissenen Franz-Domes-Heimes im Herbst 1989 fanden alle Premieren der Außenbezirkstourneen im Akzent-Theater, welches zum Bildungszentrum der Arbeiterkammer Wien im IV. Bezirk gehört, statt.
[S. 62] 5. Publikum, Zielgruppen, AbonnentInnen
„Man überschätze und unterschätze jene Publikumsschicht nicht, die heute, politisch gesehen, Träger des Gewerkschaftsgedankens und seiner Machtposition ist, und kulturell gesehen, sich aus Menschen zusammensetzt, die man nicht ohne leichten Unterton der Geringschätzung, die breite Masse zu nennen pflegt. Es sind Menschen, die durch ihre speziellen Berufspflichten weitgehend daran gehemmt sind, sich mit kulturellen Werten ausführlich auseinanderzusetzen.“ So beschrieb die sozialdemokratische Zeitschrift „Die Zukunft“ das Publikum des Volkstheaters in den Außenbezirken, ohne dabei auf ein ins Positive gewandtes Klassenklischee zu verzichten: „Der scharfe, aber doch nicht geschulte Verstand eines einfachen Arbeiters ist sicherlich ungleich wertvollerer kultureller Humus als der angeborene Unverstand eines ewigen Playboys der oberen Zehntausend, an dem jede Schulung von vornherein verloren ist.“36
Das Zielpublikum des Volkstheaters in den Außenbezirken war bei seiner Gründung klar definiert: ArbeitnehmerInnen samt deren Familien, also jene Gruppen der Wiener Bevölkerung, die interessenpolitisch durch ÖGB und Arbeiterkammer vertreten und die an der Peripherie der Stadt nicht selten in den von der Stadt Wien errichteten Gemeindebauten wohnhaft sind.37
Dieses Publikum konnte im Prinzip auch erreicht werden. Wie hoch der anfängliche Nachholbedarf dieser Schichten im theaterkulturellen Bereich war, zeigt sich daran, dass die ersten vier Vorstellungen von zirka 40.000 Menschen besucht wurden. Doch zwischen der Saison 1959/60 und 1973/74 halbierte sich die BesucherInnenzahl. Einzig das Jubiläumsjahr 1962/63 (das 10. Spieljahr) stach mit 73.215 BesucherInnen aus der Bilanz hervor.38 Erst die mit der Saison 1975/76 durchgeführte Reform im Abonnentensystem bewirkte Rekordbesuchs- und Abonnentenzahlen: Etliche Spielstätten waren völlig, viele zur Hälfte ausabonniert. In der Spielzeit 1979/80 stand in der Außenbezirkstournee ein Sitzangebot von rund 10.000 Plätzen pro Aufführungsserie zur Verfügung, wovon 8.457 Sitzplätze abonniert waren. Hinzu kamen noch die AbonnentInnen der Kulturzentren im Burgenland, welche ab 1977 von der Außenbezirkstournee bespielt wurden.39 Zwischen 1980/81 und 1984/85 stieg die Zahl der AbonnentInnen von 8.760 auf 9.919 an. 1988/89 lag [S. 63] die AbonnentInnenzahl in den Außenbezirken bei 8.875, 1991/92 bei 8.550.40 1990 standen dem Außenbezirkspublikum fast 10.000 Sitzplätze zur Verfügung. Davon waren rund 9.000 in Abonnements vergeben.41
Diese dominierende Form der Publikumsbindung durch ein Abonnement lässt beim Publikum auf ein spezifisches, wenig experimentier- und probierfreudiges Rezeptionsverhalten schließen. Demgemäß orientiert sich die künstlerische Arbeit des Volkstheaters in den Außenbezirken auch hauptsächlich an den Wünschen des Stammpublikums. Das daraus resultierende starre Regiekonzept charakterisiert die Arbeit des Volkstheaters in den Außenbezirken von der Gründung bis heute. In vielen seiner Vorstellungen zeigte es ein „moralisierendes Besserungstheater“, in einem zunehmenden Maße auch leichtes „Unterhaltungstheater“, womit es offenbar den Wünschen des älteren Stammpublikums entspricht, was in der Folge auch zum Bild der „beharrlichen GewohnheitsbesucherInnen“, denen keine modernen avantgardistischen Stücke zuzumuten sind, geführt hat.42
In den 50 Jahren des Bestehens des Volkstheaters in den Außenbezirken sind sowohl im sozialen Umfeld des Publikums als auch im Feld der Alltagskultur wesentliche Veränderungen eingetreten. In den 1950er und 1960er Jahren war die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit wesentlich höher als heute, wodurch es sich damals auch als schwieriger erwies, nach einem langen Arbeitstag nach Hause an die Peripherie der Stadt zu gelangen und sich, dem Kleiderzwang der großen Theaterhäuser des Zentrums entsprechend umgekleidet, gleich wieder in das Zentrum zu begeben. Garderobe und Kleiderzwang stellten damals noch eine zusätzliche soziale und finanzielle Hürde für einen Theaterbesuch dar.
Zur Überwindung der mentalen Hemmschwellen für einen Theaterbesuch trug sicherlich die soziale Einbettung durch den Tourneeleiter bei. Diese „familiäre Atmosphäre“ wurde unter der Tourneeleitung von Karl Schuster besonders gepflegt: Das Abonnentenpublikum kannte einander, es legte Wert auf die ihnen bekannten SchauspielerInnen sowie auf die persönliche Betreuung durch den Tourneeleiter. Dazu gehört, dass der Prinzipal das Publikum an jedem Vorstellungsabend begrüßt, notwendige [S. 64] organisatorische Hinweise an die ZuschauerInnen richtet und auch vor der Vorstellung sowie während der Pause für Fragen, Anregungen und Beschwerden des Publikums zur Verfügung steht.43 In einigen Spielstätten wurde das Publikum darüber hinaus zu so genannten „Theatergesprächen“ eingeladen. Unter der Leitung von Anton Stiepka wurde die Möglichkeit geboten, über das laufende oder andere Stücke der Tournee zu diskutieren. Eine in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer Wien durchgeführte Publikumsbefragung bestätigte die hohe Wertschätzung dieser persönlichen Begegnung sowie die ungezwungene Atmosphäre in den Außenbezirksveranstaltungen. Darüber hinaus schätzten neun von zehn der Befragten die Nähe der Spielstätten zu den deren Wohnorten sowie die günstigen Preise.44
Vor allem für die ältere Generation des Publikums ist diese „Klubatmosphäre“ von besonderer Bedeutung: Man ist unter sich, wird in der Kunstvermittlung aber auch nicht allein gelassen. Auch akzeptiert die Bevölkerung ab 50 Jahren die Mehrzweckhallen in den großen Wohnanlagen nach wie vor als Versammlungs- und Kommunikationsorte. Dieses Publikum weist einige Verhaltensmuster auf, die mehr zur „Klubatmosphäre“ einer Parteiveranstaltung, als zu einem „Hochkulturschema“ passen. So wird zum Beispiel erwartet, dass die Vorstellung erst beginnt, wenn der letzte Besucher seinen Sitzplatz eingenommen hat. Nach dem Ende der Vorstellung verlässt der Großteil des Publikums sehr rasch die Spielstätte und begibt sich zumeist unmittelbar nach Hause, womit der Bildungsauftrag, verschiedene gesellschaftspolitisch relevante Themen so aufzubereiten, dass daraus Diskussionen entstehen können, offenbar nicht eingelöst wird.45
Aber nicht nur der Bildungsauftrag erscheint – selbst für die älteren Publikumsschichten – als antiquiert. Auch die Bindung eines relativ homogenen Publikums an ein bestimmtes kulturelles Angebot über einen längeren Zeitraum hinweg wird immer seltener. Das in den letzten Jahrzehnten zunehmend „individualisierte“ Publikum strebt auf Grund der vielen Angebote einer „Freizeit- und Erlebnisgesellschaft“ nach immer neuen Erlebnissen. Es bildet sich oft spontan und zeitlich begrenzt ein „Kollektiv“, das ein Einzelerlebnis, einen „Event“, konsumiert. Im Gegensatz dazu ist der Besuch einer Vorstellung des Theaters [S. 65] in den Außenbezirken eine organisierte Veranstaltung in einem und für ein spezifisches Milieu.
6. Entwicklungen und Veränderungen in Programm und Spielplan
Schon das erste Stück des Volkstheaters in den Außenbezirken, die antimilitaristische Komödie „Helden“ von Bernard Shaw, dem prononcierten Vorkämpfer gegen jedweden Bildungssnobismus, war programmatisch und stand für ein kritisches, zugleich vergnügliches und geistig anspruchsvolles Theater. Entsprechend positiv war die Resonanz sowohl von den BesucherInnen als auch von den anwesenden BehördenvertreterInnen, SchauspielerInnen und der Volkstheaterdirektion.46 Die weiteren Aufführungen der ersten Saison führten die gesetzten Akzente fort: Gerhart Hauptmanns „Der Biberpelz“, Schillers „Kabale und Liebe“ und Molières „Tartuffe“.
Bereits in der 2. Spielzeit 1954/55 stand als erste Nestroy-Posse „Unverhofft“ auf dem Spielplan. Damit wurde die Tradition des Altwiener Vorstadttheaters in neuartiger Weise fortgeführt: Auf Nestroy folgten Raimund, Goldoni, Anzengruber, Horváth, Herzmanovsky-Orlando, Ludwig Thoma, Philipp Hafner, aber auch Federico Garcia Lorca. In der Spielzeit 1955/56 gastierte die Exl-Bühne mit Karl Schönherrs „Erde“ in den Außenbezirken, das einzige Gastspiel eines fremden Ensembles innerhalb der Aktion.47
Eine Außenbezirkstournee gestaltet sich im Regelfall nach einem eingespielten Muster: Im Frühjahr und Sommer werden die ersten Stücke der neuen Spielsaison festgesetzt, die Regisseure, Bühnen- und KostümbildnerInnen bestimmt und die einzelnen Rollen besetzt. Ab dem Sommer wird in den Volkstheaterwerkstätten an der Dekoration und an den Kostümen gearbeitet, und die ersten Proben mit den SchauspielerInnen beginnen. Mit den letzten Proben startet auch die Arbeit mit den Bühnenarbeitern und der Beleuchtung. Dann kommt das Lampenfieber und die Premiere. Und nach jeder Vorstellung muss das Bühnenbild wieder abgeräumt, verpackt und abtransportiert werden. Denn oft wird bereits am nächsten Tag an einer anderen Spielstätte gespielt.48
[S. 66] In diesem Rhythmus eilt das Volkstheater in den Außenbezirken mit dem motorisierten Thespiskarren durch die Vororte und Trabantenstädte der Stadt, von Spielort zu Spielort, von Aufführung zu Aufführung zu seinem Publikum. Und das Publikum folgte der Einladung: Die Erfolgsstücke der ersten Saisonen waren 1954 Gerhart Hauptmanns „Der Biberpelz“ mit 8.856 BesucherInnen in 17 Aufführungen, 1955 Thornton Wilders „Unsere kleine Stadt“ mit 8.640 BesucherInnen in 20 Aufführungen und 1956 Karl Schönherrs „Erde“ mit 9.399 BesucherInnen in 22 Aufführungen, 1957 Barry Conners „Roxy“ mit 8.844 BesucherInnen, 1958 Bernard Shaws „Die Häuser des Herrn Sartorius“ mit 9.980 BesucherInnen, 1959 Friedrich Schillers „Der Neffe als Onkel“ mit 10.055 BesucherInnen. In diesem Jahr standen bereits 83.704 Plätze für 70.332 Theaterbegeisterte zur Verfügung.
Inhaltlich waren in den ersten zehn Jahren Stücke mit sozialen Themen stärker gefragt als leichte Unterhaltungsstücke. In Publikumsbefragungen, aber auch in vom Publikum eingebrachten schriftlichen Reaktionen wurden vor allem Klassiker der Weltliteratur verlangt, was auf einen gewissen diesbezüglichen „bildungsproletarischen“ Nachholbedarf schließen lässt. Doch bereits Anfang der 1960er Jahre wurden die Auswirkungen eines betont materiellen Konsums der Hochkultur sowie neuer, stärker kulturabgewandter Freizeitgewohnheiten, aber auch der Einfluss des Fernsehens auf das Publikum in den Randbezirken der Stadt konstatiert.49
In der Zeit der Volkstheater-Direktion von Gustav Manker (1969-1979)50 wurde das Volkstheater in den Außenbezirken in grundsätzlich ähnlicher Weise fortgeführt, wie es von Leon Epp konzipiert worden war. Als zweite Spielstätte des Volkstheaters bildete es weiterhin einen festen Bestandteil in der Theaterarbeit. Denn der Betrieb in den Außenbezirken bot dem Haupthaus mannigfache Vorteile: So konnte etwa das Ensemble größer gehalten sein, als es für eine Bühne allein möglich gewesen wäre. Junge SchauspielerInnen, die im Haupthaus nur in kleinen Rollen beschäftigt werden konnten, hatten in den Außenbezirken die Möglichkeit, sich in größeren Rollen zu präsentieren. Und vor allem verursachte der Betrieb dank der Förderung durch die Arbeiterkammer kaum Mehrkosten.
[S. 67] Volkstheater-Direktor Manker, der als Regisseur im Februar 1963 den so genannten „Brecht-Boykott“ mit der Aufführung von „Mutter Courrage und ihre Kinder“ beendet hatte und damit neben dem bereits klassisch gewordenen Wedekind-Zyklus und seinen zeitgenössischen Nestroy-Inszenierungen eine vorzügliche Brecht-Pflege am Wiener Volkstheater einleitete,51 widmete seine erste Außenbezirkssaison 1969/70 gänzlich österreichischen Autoren, da „das Publikum in den Randgemeinden sich erfahrungsgemäß von ,heimischen Themen‛ am stärksten angesprochen fühlt.“52 In der Saison 1976/77 wiederholte Manker übrigens diesen Österreich-Schwerpunkt in den Außenbezirken, wobei er in der ersten und letzten Premiere, Schnitzlers „Anatol“ und Nestroys „Lumpazivagabundus“, selbst Regie führte.
Insgesamt gesehen bot Mankers Direktionszeit eine Mischung aus Pflichtbildungsgut und neuen Perspektiven. Die vielen Premieren verwöhnten das Publikum. Dazwischen gab es mutige Vorstöße im Bereich der zeitgenössischen österreichischen Literatur.
Doch in den 1970er Jahren hatte das fortschrittliche Volkstheater progressivere Konkurrenz bekommen. Vor der kulturpolitischen Hintergrundfolie der liberaldemokratischen Ära Kreisky, in der es auch zu moderaten Manifestationen einer demokratischen Gegenkultur wider die etablierte bürgerliche Hochkultur kam („Arena-Besetzung“, WUK, Amerlinghaus, Kulisse, Metropol), fanden auch auf dem Theatersektor Initiativen zu einer dezentralen Theaterarbeit statt: so etwa mit der „Gruppe 80“, dem Jura-Soyfer-Theater am Spittelberg, dem 1979 gegründeten Fo-Theater in den Arbeiterbezirken, das später als „GemeindeHOFtheater“ um Didi Macher und Otto Tausig durch die Höfe der Gemeindebauten des „Roten Wien“ tourte, aber auch in die Betriebe ging, um dort bei freiem Eintritt Menschen kritisches und politisches Volkstheater näherzubringen, die sonst nicht in das Theater gingen. Trotz großer Erfolge beim Publikum stieß das linke „Vagabundentheater“ auf massive Widerstände von Seiten sozialdemokratischer Bezirkspolitiker, des ORF und des ÖGB. Denn auf der Pawlatschenbühne wurden derbe, hochpolitische Schwänke und Agit-Prop-Theater nach dem Vorbild von Dario Fo gespielt, und nicht „sozialdemokratisches Gewerkschaftstheater“.53
[S. 68] Experimente diesbezüglicher Art, oder einen ausgefalleneren Spielplan akzeptierte das Publikum in den Außenbezirken nicht. Man wollte nicht allzu schwer verdauliches „Bildungstheater“, in zunehmendem Maße leicht verdauliches „Unterhaltungstheater“. Leon Epp hatte demgemäß zunächst mit einem „ausgesprochenen Bildungsprogramm“54 begonnen, war aber schließlich zu einer „kulturerzieherischen Balance zwischen Klassik und Zeitgenössischem“ gelangt. Gustav Manker setzte dieses Konzept mit reduzierter Anzahl der Premieren (von acht auf sieben Stücke in der Saison) fort, und stellte bezüglich der Rezeptionskultur des Außenbezirkspublikums fest: „Das Publikum bevorzugt einerseits beliebte Schauspieler, andererseits reagiere es auch auf Stücke, und zwar durch Wegbleiben bei der nächsten Aufführung, wenn es sich um ,schwierige Brocken‛ gehandelt hat.“55
Die volksbildnerische Aufgabe, die man sich anfangs gestellt hatte, schien nicht mehr ganz zeitgemäß. Die Zahl der ZuschauerInnen war von anfangs zirka 70.000 auf zirka 30.000 in der Saison 1970/71 zurückgegangen. Auch die AbonnentInnenzahlen waren Anfang der 1970er Jahre rückläufig. Mit der Ausrichtung auf den traditionellen Spielkanon gelang es auch nicht, neues und vor allem jüngeres Publikum anzusprechen. Der/die durchschnittliche BesucherIn war um die 50 Jahre alt. Obwohl die Karten nach wie vor sehr billig waren, blieb dennoch eine große Zahl an Plätzen täglich frei.
Den Anfang der 1970er Jahre absinkenden BesucherInnenzahlen des Volkstheaters in den Außenbezirken versuchte man mit verschiedenen Konzepten entgegenzutreten: So entschloss man sich, aus Werbegründen Freikarten an Bundesheerangehörige sowie an Jungarbeiterinnen und Jungarbeiter zu verteilen. Man zog in Erwägung, die Vorstellungen schon um 19 Uhr beginnen zu lassen und in einem Nebenraum eine Art Kindergarten für Kinder junger Familien einzurichten. Man fragte sich aber auch, „ob der Theaterbesuch vor der Haustüre heute tatsächlich noch den Vorstellungen entspricht. Ob man nicht mit dem Theaterbesuch die abendliche Fahrt in die Stadt verbindet, die ja unter Umständen mit gemieteten Autobussen erreicht werden könnte.“56
Trotz beeindruckender Zwischenbilanz – bis Dezember 1971 [S. 69] waren 1,136.487 Besucherinnen und Besucher in 3.398 Vorstellungen gekommen – und trotz beginnender Nachahmung dieses Theaterkonzepts in verschiedenen Städten Deutschlands (Hamburg, Dortmund, München), war unterdessen in Wien jenseits des Gürtels die Neugierde versickert. Gründe wurden viele ins Spiel gebracht: das Fernsehen, die zunehmende Motorisierung, die die Distanz zum Stadtzentrum verringerte. Aber letztlich stand man vor der bitteren Erkenntnis, dass der zunehmende Wohlstand, entgegen idealistischer Erwartungen, das Kulturbedürfnis der breiten Massen bislang kaum geweckt, die zunehmende Freizeit die Bereitschaft zur kulturellen Beschäftigung nicht gefördert hatte: „Die Devise wird künftighin Kultur trotz Massenwohlstandes lauten müssen“57, resümierte der Kritiker und spätere Volkstheaterdirektor Paul Blaha.
In dieser Krisenphase – man spielte sogar mit dem Gedanken, die Außenbezirkstournee überhaupt aufzulösen – hatte im Jahr 1973 Karl Schuster den Posten des Tourneeleiters übernommen. Dank seines Engagements und infolge der Einführung des AK-Theaterabonnements stieg die Besucherzahl wieder von 39.158 (1974/75) auf 40.305 (1975/76) und schließlich auf 55.873 in der Saison 1976/77. In diesem Zeitraum erhöhte sich der Abonnentenanteil auf 81 Prozent. Die Auslastung betrug 96 Prozent, obwohl das Platzangebot um rund 5.000 Sitzplätze zugenommen hatte.58
Trotz des Aufschwungs an Publikum und AbonnentInnen Mitte der 1970er Jahre blieb die Theateraktion innerhalb der Presse nicht unkritisiert. Exemplarisch sollen zwei gegensätzliche Medien zitiert werden.
In der „Volksstimme“ meinte im September 1976 Arthur West, dass der Spielplan der „rückschrittlich-biederste aller Wiener Spielpläne“ wäre: „Insgesamt ein Angebot, das dem Illusions- und Beschönigungstheater bürgerlichen Zuschnitts weitere Tore in die ,Arbeitnehmerschaft‛ öffnet, weiterer Entfremdung zwischen Arbeiterschaft und echtem – darum nicht minder ,unterhaltendem‛ – Bühnenanliegen dient und alles benötigte Problembewußtsein weiter unterhöhlt.“59 Dass damit den arbeitenden Menschen jedes Problembewusstsein genommen werde, sei nicht mit den Bildungsverpflichtungen der Arbeiterkammer und des ÖGB vereinbar, so West.
[S. 70] Auf der anderen Seite wetterte Peter Kaizar im März 1977 in der „Kronen Zeitung“ gegen die „attraktive(n) Kulturpakete“, welche die Arbeiterkammer in die Außenbezirke verschickt: „Einfach so. Hauptsache, die Säle sind voll. Geboten wird schlechtes, langweiliges Theater. Kommerzware. Also schlicht: ,Tödliches Theater‛ [...] Die Verantwortung? Sie wird delegiert. Zuletzt heißt’s: ,Des mocht ollas da Manker!‛ Also gut, der Herr Direktor, Big Boss des Volkstheaters. Der dann so via Rundfunk zu resümieren pflegt: ,Das Publikum in den Außenbezirken ist sehr angenehm – weil es so naiv ist ...‛ Wie bitte? Ist das Zynismus oder Polemik? Oder ist einfach Überheblichkeit dabei? Mankers ständiges Abtun moderner Autoren kennt man ja. Die Barrieren, die er im Theater aufbaut. Die Art und Weise, wie Stücke erarbeitet werden. Ohne Auseinandersetzung mit dem Stoff. Geschweige denn mit Aktualisierung. Lemurentheater? Dann latscht man einen Stock tiefer. In die ,Außenbezirke‛. Dort, wo also die Naiven hocken. Die sollen auch ,Kultur‛ inhalieren. Möglichst belanglose. Unwichtige. Das ist ,Volksbildung‛. Zahlen und Statistiken stapeln sich. Und sagen eigentlich nichts aus. Denn Quantität hat nichts mit Qualität zu tun. Und Bildung hat nichts mit seichter Konsumation zu tun. Und wer bestimmt denn, dass das Volkstheater die ,Außenbezirke‛ gepachtet hat? Es gibt genug junge Gruppen, für die das Ganze eine Aufgabenstellung wäre. Abgesehen von aktuellem Theater – wer sagt, dass andere Gruppen keinen Nestroy spielen können? Vielleicht sogar viel besser! Also, weg vom tödlichen Theater!“60
In diesen Jahren öffneten sich auch die Volkshochschulen verstärkt der Theaterarbeit. An der Volkshochschule Hietzing etablierte sich ein eigener Theaterschwerpunkt. Man fungierte nicht ausschließlich als eine Spielstätte des Theaters in den Außenbezirken, sondern stand auch als Probe- und Aufführungsort verschiedener Amateurtheaterensembles zur Verfügung. Zwischen Mai und Juni 1977 fand unter der Leitung von Hilde Weinberger ein Theatertreffen statt, an dem Theatergruppen wie der „Club Hamlet“, das „Theater im offenen Kreis“, das „Ensemble Theater im Werkraum“, das „Theater Virus“, das „Team 65“, das „Kleine Theater/Brühl“ oder die „Gruppe DAS“ auftraten. Ein Theater-Seminar bot Gelegenheit, sich an einem Wochenende intensiv mit Theaterarbeit auseinanderzusetzen. Im Anschluss [S. 71] an Aufführungen von Stücken von Peter Weiss oder Jean Paul Sartre wurden diese mit dem Publikum diskutiert. Ziel des Theatertreffens 1977 war, möglichst breite Bevölkerungsschichten anzusprechen, doch strömten interessanterweise gerade jüngere Publikumsschichten zu den Veranstaltungen. Im Anschluss kam es zur Gründung einer Theaterkooperative zwischen professionellen SchauspielerInnen und AmateurInnen, welche sich dem Namen „Zur Schaubude“ gab und die etwa mit der Eigenbearbeitung von „Der Zerissene“ von Johann Nestroy sozialkritische Akzente setzen wollte. Unter dem Titel „Treffpunkt Theater“ wurden in einem Club die Aufführungen des Volkstheaters in den Außenbezirken mit dem Publikum diskutiert.61 Fallweise standen SchauspielerInnen, Regisseure und Dramaturgen des Volkstheaters sowie Kritiker Wiener Tageszeitungen als Gesprächspartner zur Verfügung. Das Interesse war aber gering, sodass die Aktion bereits im März des folgenden Jahres einschlief. Ebenfalls fehl schlug eine „Theatergesprächs“-Aktion an der Volkshochschule Wien-Nord.62 Im Kursjahr 1978/79 veranstaltete die Volkshochschule Ottakring, an der Hilde Weinberger als Leiterin des dramatischen Studios „Theater im Werkraum“ wirkte, einen Jahreskurs zum Thema „Aktuelles aus Theater, Film, Fernsehen“, der einer ähnlichen Intentionen folgte.
Die theaterpolitische Situation im Wien der 1980er Jahre, und damit der Zeit der Volkstheater-Direktion Paul Blahas (1979-1987), beschrieb die Literaturkritikerin Sigrid Löffler folgendermaßen: „Zu einem Zeitpunkt, da in der Bundesrepublik eine neue Generation von Regisseuren die großen Glaubenskriege der späten sechziger und der siebziger Jahre um eine neue Theaterästhetik längst erledigt (und für sich entschieden) hatte, hielten die kulturell dominanten Schichten in Österreich immer noch an überholten Vorstellungen von Klassikerpflege und Bildungstheater fest – und das, obwohl die offizielle Kulturpolitik seit über einem Jahrzehnt in sozialistischen Händen lag. [...]
Die sozialistischen Kulturpolitiker auf Stadt- und Bundesebene hielten die Theaterdinge, so wie sie lagen, für adäquat geordnet. Das Wiener Kleinbürgertum sah sich in einer konservativen Spielart eher im Josefstädter Theater und in einer sozialdemokratischen Variante eher im Volkstheater aufgehoben. Für das Bildungsbürgertum, das sich und seine gymnasialen Bildungsrückstände [S. 72] in Klassiker-Aufführungen bestätigt sehen wollte, war das Burgtheater-Abonnement da. Und dem theatralen Zeitgeist wurde auch ein bißchen Rechnung getragen: dem wurde in Hans Gratzers Schauspielhaus in der Wiener Porzellangasse eine kleine Boutique für Theatermoden eingerichtet.“63 Und, so möchte man hinzufügen, im Volkstheater in den Außenbezirken wurde sozialdemokratisches „Bildungs- und Unterhaltungstheater“ für ein weniger experimentierfreudiges Vorstadtpublikum geboten. Diese Rollenverteilung schien, nicht zuletzt auf Grund nach wie vor ausreichend fließender öffentlicher Dotationen, erstaunlich lange zu funktionieren. Zur Zeit des Direktionsantritts von Blaha waren auch für das Volkstheater noch genügend finanzielle Mittel vorhanden, um Experimente auf kulturellem Sektor durchzuführen. Am Ende seiner Direktionszeit 1987 hatte sich die Situation bereits beträchtlich geändert. Es fiel den Geldgebern zunehmend schwerer, gegenüber dem Wahlvolk die finanziellen Zuwendungen an ein defizitäres Theater zu rechtfertigen.
Auch Blahas Volkstheater war politisch engagiert und stand für ein „Theater mit Gesinnung“. Der Spielplan war durchaus anspruchsvoll, großes Welttheater stand neben Komödien und Zeitkritik, russische Klassiker wie Tschechow oder Gorki neben Schnitzler und Nestroy, aber auch Brecht sowie interessante Entdeckungen slowenischer Stücke. Blahas Aufmerksamkeit galt Autoren wie Peter Turrini und Heinz R. Unger, aber auch Stücken der Vergangenheitsbewältigung, wie etwa „Ghetto“ von Joshua Sobol, das am Haupthaus mit einem israelischen Team inszeniert wurde. Für das Volkstheater in den Außenbezirken übernahm Blaha das Eppsche Konzept eines ausgewogenen Spielplans. Das Publikum war auch bereit, Dario Fo und Peter Turini zu akzeptieren, wenn es dafür seinen Nestroy und Molnár bekam.
Vor allem in der Zeit der Direktion Paul Blahas kam es zu einer gewissen Umkehrung des Diffundierungswegs der Theaterkultur von der Peripherie in das Zentrum. Weil in der Saison 1979/80 „Das Bündel“ von Edward Bond mangels Publikumserfolgs im Haupthaus abgesetzt wurde, übernahm man die Außenbezirksproduktion „Blick von der Brücke“ von Arthur Miller als Ersatzvorstellung. Weitere Ersatzvorstellungen durch Außenbezirksinszenierungen [S. 73] folgten: 1981/82 „Erde“ von Karl Schönherr, 1982/83 „Umsonst“ von Johann Nestroy, 1983/84 „Der Preis“ von Arthur Miller, 1984/85 „Mirandolina“ von Carlo Goldoni, „Die verhängnisvolle Faschingsnacht“ von Johann Nestroy, 1985/86 „Wie man Karriere macht“ von Alexander Ostrowski, 1986/87 „Der Trauschein“ von Ephraim Kishon, 1987/88 „Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert, „Hôtel du Commerce“ von Fritz Hochwälder, „Riesenblödsinn“ von Karl Valentin und „Halbe Wahrheiten“ von Alan Ayckbourn. Andere Produktionen wie „Der Geizige“ von Molière, „Der Diener zweier Herren“ von Goldoni, „Der Schulfreund“ von Simmel und „Ein besserer Herr“ von Hasenclever waren bereits für eine Übernahme in das Haupthaus am Weghuberpark projektiert gewesen.64 Ebenso „Der Himbeerpflücker“ von Fritz Hochwälder, „wohl einer der wichtigsten und gelungensten Aufführungen für die Außenbezirkstournee“.65 Da das Stück „Der Frieden“ von Peter Hacks, frei nach Aristophanes, wegen Publikumsverweigerung auf Grund scheinbar unzumutbarer „Obszönitäten“ aus dem Abonnement genommen wurde, bestand das Volkstheater-Repertoire Anfang 1986 sogar ausschließlich aus Außenbezirksaufführungen: „Der Trauschein“ und „Der Geizige“ von Molière sowie ab März 1986 Hochwälders „Himbeerpflücker“.66 Auch wenn oft aus einer Zwangslage des Haupthauses heraus entstanden: Die Peripherie kehrte so in gewisser Weise in das Zentrum zurück. Teilweise sogar mit Hilfe von Autobussen: Angesichts des Besucherschwunds im Haupthaus dienten Gratisfahrten als Lockmittel für die Theaterkunst. Autobusse führten AbonnentInnen aus Liesing, Floridsdorf und Hietzing zum Volkstheater am Weghuberpark, die dort zum halben Preis „Wilder Honig“ oder „Der Bürger als Edelmann“ sehen konnten.67
Am 15. März 1987 konnte der 2,000.000ste Besucher im „Haus der Begegnung Floridsdorf“ im Rahmen der Vorstellung „Der Schulfreund“ von Johannes Mario Simmel begrüßt werden. Mit „Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert beging man die 250. Inszenierung. Von der Kritik wurde sie jedoch überwiegend negativ aufgenommen: „Das Ensemble des Volkstheaters spielt diesen Klassiker einer auch schlimmen Zeit als 250. Inszenierung ihrer Außenbezirkstournee. Und hier wenigstens gibt es eine Art Klammer, die viel Zeit zusammenhält: Diese verdienstvolle [S. 74] Institution ist immer noch so, wie sie war. Karg, bemüht, voll guter Absicht und dennoch niemals überwältigend. Ob die aus Floridsdorf oder Liesing angesichts einer solchen Darbietung wirklich noch dazu animiert werden, einmal ins Haupthaus des Volkstheaters zu kommen? [...] Wer – in Anlehnung an Borchert – nach ,Draußen vor der Tür‛ noch Mut zum Theaterbesuch hat, soll es einmal mit einer Aufführung von George Taboris ,Der Kreis‛ versuchen.“68
Demgegenüber meinte der Kritiker Hans Weigel anlässlich der gleichen Premiere, dass das „Theater von nebenan“ ein Wunder an Lebensfähigkeit sei: Immer wieder wären alle Attacken aufgefangen und alle Vorwürfe zerstreut worden. Weigel forderte daher die Arbeiterkammer Wien auf, den Theaterbetrieb auch in Zukunft sicherzustellen, da er ein zentraler Bestandteil des Wiener Kulturlebens sei.69
Im so genannten „Gedenkjahr“ 1988 wurde vom Interimsdirekor Rainer Moritz, dessen theaterpolitisches Kredo lautete, „daß es am Theater einen unerbitterlichen Gradmesser gibt, den Blick in den Zuschauerraum“70, „Der Schulfreund“ von Johannes Mario Simmel aus den Außenbezirken in das Haupthaus geholt. In den Außenbezirken spielte man Brecht, Nestroy, Gogol, Anouilh, Dario Fo und Jean Paul Sartre. Mit „Der tollste Tag“ von Peter Turrini, frei nach einer Beaumarchais-Vorlage, fand im Oktober 1989 die gefeierte Premiere der Außenbezirkstournee erstmals im neu eröffneten Theater Akzent statt.71
7. Das „(Volks-)Theater in den (Außen-)Bezirken“ zwischen Vergangenheit und Zukunft
Nach der kurzen Interimszeit von Rainer Moritz, dem späteren kaufmännischen Direktor, übernahm am 1. September 1988 Emmy Werner die Direktion des Volkstheaters. Sie trat an, ein Theater zum Aufregen, Anregen und Unterhalten machen zu wollen, ein „sehr österreichisches, handfestes, sinnliches Volkstheater“ führen zu wollen. Mit Werner, die vom En-suite-Theater zum Repertoire-Theater zurückkehrte, kam erstmals auch ein feministisch gesetzter Anspruch in der Programmgestaltung zur Geltung. Dies drückte sich einerseits im forcierten Einsatz von Regisseurinnen aus, andererseits wurde exemplarisch gezeigt, [S. 75] wie man Stücke von Elfriede Jellinek inszenieren kann. Demonstrativ wurde die jährliche Eröffnung der Theatersaison mit einer „großen Frauengestalt der Weltliteratur“ begangen. Man scheute sich aber auch nicht vor aktuellen politischen Statements, wie die im „Wendejahr“ 2000 stattgefundenen Veranstaltungen im Rahmen der Reihe „Unruhiges Österreich“ zeigen, die sich kritisch zur politischen Lage in Österreich seit der ÖVP/FPÖ-Regierung äußerten.72 So wurde unter der Direktion von Emmy Werner in kurzer Zeit aus dem etwas in Misskredit geratenen Volkstheater ein interessantes, profilreiches Theater. Das Volkstheater fischte aus der freien Theaterszene und begann dem Burgtheater unter Claus Peymann und der Josefstadt den Rang abzulaufen: „Peymann ist der verschwenderische, reiche, schlampige Bruder. Er hat zwei Cousinen: eine langweilige, die Josefstadt, und eine unternehmungslustige, das Volkstheater“73, formulierte die Theaterkritik.
Der neue Schwung schien sich jedoch beim Volkstheater in den Außenbezirken nicht einzustellen, obgleich es für Emmy Werner von Grund auf erneuerungsbedürftig war: „Das ist alles Schmalspur, bieder, nicht aufregend.“74 Doch eine konkrete Reform wurde hinausgezögert. Zu kompliziert schienen die verschiedenen Interessen von Arbeiterkammer, Volkstheater und AbonnentInnenstamm verwoben zu sein: Die „Bedürfnislage der Leute“ schien für Werner „eher in die Richtung Unterhaltung (zu gehen). Das kollidiert aber mit den Ansprüchen von Arbeitnehmerorganisationen, den Bildungsauftrag zu erfüllten. Das ist immer noch ein schwieriges Kapitel.“75
Für das „Unterhaltungstheater“ als Gegenpol zu einem verstaubten „Bildungstheater“ wurde in der Presse jedoch durchaus eine Lanze gebrochen: „Einst als Bildungsprogramm für die Arbeiterschaft ins Leben gerufen, haben sich die Aufführungen des Volkstheaters in den Außenbezirken längst zum Anlaß für einen vergnüglichen Abend gewandelt. [...] Wer heute Ibsen und Grillparzer, Tschechov und Bernhard sehen will, hat sie nicht nur live vor der Haustür [...], sondern kann sie sich auch fernsehkonserviert ins Wohnzimmer liefern lassen.
Die alten Kleider passen nicht mehr, neue sind schwer anzumessen, weil im sozialistischen Wien (heutzutage) Veränderungen nicht gern gesehen werden. Deshalb wurschtelt so manche [S. 76] Volkshochschule immer noch hinter dem Diaprojektor herum, und deshalb spielt das Volkstheater ebendort Strindberg und Havel und riskiert damit, daß es nicht ernst genommen wird. Mehr als 9.000 AbonnentInnen, an die 30 Vorstellungen pro Stück zeigen jedoch, daß viele eine Unterbrechung des alltäglichen Glotzvergnügens herbeisehnen, daß sie bereit sind, sich ,in Schale‛ zu werfen, um sich zu unterhalten. Und genau das sollte das ,Volkstheater in den Außenbezirken‛ bieten, Unterhaltung, und die muß nicht einmal gehoben sein. [...]
Unterhaltung gilt an den großen Häusern ohnehin als pfuigack, und wer nicht am Stück und an der Inszenierung leidet, muß dies an den Sesseln tun, in die er üblicherweise mehr als vier lange Stunden gepreßt ist. Die alten Griechen haben ihre heiligen Theaterabende mit einem derb-fröhlichen Satyrspiel abgeschlossen – leise schmunzelndes oder lauthals schallendes Vergnügen ist also von ganz oben abgesegnet. Es darf und soll gelacht werden – die Säle der Volkshochschulen, Bildungshäuser und Jugendzentren in den sogenannten Außenbezirken sind der geeignete Ort dafür.“76
Mit der Spielsaison 1990/91 wurde die Zahl der Aufführungen von acht auf sieben reduziert, davon waren mindestens die Hälfte Komödien. Durchschnittlich ein Stück pro Saison war ein Klassiker, bzw. bot zumindest einen Klassiker als literarische Grundlage der Bearbeitung. Ebenfalls durchschnittlich ein Stück pro Saison stammte von jungen, österreichischen und internationalen AutorInnen. Aber auch die so genannten „politischen Autoren“, wie etwa Jura Soyfer, Bertolt Brecht oder Fritz Hochwälder, waren im Programm vertreten.
Im Herbst 1993 wurde gemeinsam von Volkstheater und der Arbeiterkammer Wien der Schauspieler und Regisseur Frank Michael Weber zum Tourneeleiter des Volkstheaters in den Außenbezirken bestellt. Weber übernahm ein solides Unternehmen mit zirka 8.500 Abonnentinnen und Abonnenten, sah aber gleichzeitig Reformen als notwendig an: So sollte das Programm verbessert werden. Durch einen verstärkten Restkartenverkauf sollten mehr jüngere Besucherinnen und Besucher in die Außenbezirkstournee gelockt werden. Doch die finanziellen Mittel, die für größere Neuerungen notwendig gewesen wären, waren nicht vorhanden.77 Im Gegenteil: 1990 kam es am Haupthaus zu [S. 77] rigorosen Kürzungen, die jedoch von die Stadt Wien aufgefangen wurden. Die Arbeiterkammer kürzte ihre jährlichen Subventionen von 6,5 Millionen auf 1,5 Millionen, der ÖGB strich seine Subvention von 3,3 Millionen Schilling gänzlich. Das Budget des Volkstheaters in den Außenbezirken betrug 17 Millionen Schilling pro Saison plus die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern. Mit diesem Budget mussten alle Kosten gedeckt werden. Für Werbung und Programmhefte stellte die Arbeiterkammer zusätzlich eine Million Schilling zur Verfügung.78
Im Sommer 2001 wäre die, mit der Saison 1999/2000 in „Theater in den Bezirken“ umbenannte Theateraktion beinahe einer weiteren Einsparungswelle zum Opfer gefallen. Die Arbeiterkammer reduzierte ihre Unterstützung drastisch von 17 Millionen auf lediglich zwei Millionen Schilling, was de facto das Ende des Spielbetriebs bedeutet hätte. Doch die Stadt Wien unter Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny erklärte sich bereit, neun Millionen für die Außenbezirkstournee zuzuschießen. Dazu kamen jährliche Einnahmen aus dem Kartenverkauf in der Höhe von 3,5 Millionen Schilling. Auf Grund des reduzierten Budgets war man gezwungen, die Zahl der Aufführungen von sieben auf fünf bzw. sechs zu reduzieren.
In dieser Krisenphase erwies sich die Treue des Publikums zu seinem Bezirkstheater als wesentliche Stütze: Von den damals zirka 8.000 Abonnentinnen und Abonnenten unterschrieben zirka die Hälfte eine Petition für den Erhalt der Theateraktion. Obwohl die Abonnentinnen und Abonnenten am Ende der Saison nicht wussten, ob die Aktion überhaupt fortgesetzt wird, verlängerten 80 Prozent ihr Abonnement. Für die Abonnentinnen und Abonnenten war es offensichtlich auch keine große Hürde, die gleichen Preise für weniger Vorstellungen zu akzeptieren. Emmy Werner hatte zunächst gehofft, die Abonnentinnen und Abonnenten in das Haupthaus ziehen zu können, war aber schließlich von den Vorteilen der Außenbezirkstournee überzeugt: „Es ist ein wichtiger Treffpunkt für die Leute. Ich habe das unterschätzt. Mir war die Tournee immer ein bißchen Klotz am Bein. Ich habe sehr viel zu tun und sieben Aufführungen mehr zu programmieren, ist auch eine große Last.“79
Diese nicht zu unterschätzende soziale Dimension des „Theaters in den Bezirken“ beschreibt auch der Schriftsteller Antonio [S. 78] Fian: „Die Nachteile, die das Provinztheater hat, habe ich immer als seine größten Vorteile betrachtet. Weil Bühnenbild und -technik zwangsläufig, da man ja wandern muss, [...] auf das Notwendigste reduziert werden müssen, bleiben den Regisseuren nur zwei Säulen, die ihre Inszenierung tragen können: Schauspieler und Text.
Nirgendwo besser als in der Provinz lässt die Beschaffenheit dramatischer Literatur sich überprüfen. Besitzt sie Qualität, wie beispielsweise Jean-Claude Grumbergs in Frankreich sehr erfolgreiches Stück Das Atelier, das aus unerfindlichen Gründen erst 22 Jahre nach seiner Entstehung als Produktion des Volkstheaters in den Außenbezirken im Akzent seine österreichische Erstaufführung erlebte, kann ihr auch eine völlig indisponierte Hauptdarstellerin nichts anhaben. Besitzt sie keine, werden in der Provinz ihre Mängel schonungslos vorgeführt.
Das Provinz- bzw. Vorstadttheater hat aber vor allem ein Unschätzbares: Es ist nicht elitär. Die Experten der Kritik bleiben ihm fern. Falls die Zeitungen überhaupt jemanden in die Premieren schicken, dann Nachwuchskräfte. Auch dem Publikum verspricht der Besuch keinen Prestigezuwachs. Man kennt sich zwar, aber man geht nicht hin, um gesehen zu werden, sondern will nur für zwei Stunden austreten aus dem Alltag und Menschen dabei zusehen, die andere Menschen sich ausgedacht haben.“80
Anmerkungen:
1 Roland Barthes, Das Reich der Zeichen, Frankfurt am Main 1981, S. 47.
2 Karl Glossy, 40 Jahre Deutsches Volkstheater. Ein Beitrag zur deutschen Theatergeschichte, Wien 1929. Oskar Maurus Fontana, Volkstheater Wien. (Deutsches Volkstheater). Weg und Entwicklung (1889-1964). Mit 26 Bildbeigaben und 9 Zeichnungen, Wien 1964. Zur Geschichte und Entwicklung des „volkstümlichen“ Theaters des Wiener „Volkstheaters“ von Raimund und Nestroy bis Anzengruber vergleiche: Jürgen Hain, Das Wiener Volkstheater, Darmstadt 1997. Zum Volksstück und Volkstheater Ludwig Anzengrubers vergleiche: Johanna Maria Rachinger, Das Wiener Volkstheater in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung des Dramatikers Ludwig Anzengruber, Diss. Univ. Wien 1986. Zum Volkstheaterbau als neuem, „demokratisierteren“ Theatertypus vergleiche: Peter Haiko, Ein Theater für das Bürgertum: Das deutsche Volkstheater in Wien als Modell eines Bürger-Theaters für die gesamte Monarchie. In: Hanns Haas/Hannes Stekl (Hrsg.), Bürgerliche Selbstdarstellung. Städtebau, Architektur, Denkmäler (= Bürgertum in der Habsburgermonarchie, Bd. 4), Wien-Köln-Weimar 1995, S. 153-162.
3 Johann Hüttner, Das Theater als Austragungsort kulturpolitischer Konflikte. In: Evelyn Schreiner (Hrsg.), 100 Jahre Volkstheater. Theater, Zeit, Geschichte, Wien-München 1989, S. 13. Anna Grünwald, Die Wiener Freie Volksbühne, Diss. Univ. Wien 1932. Stefan Großmann, Die Wiener Freie Volksbühne. In: Zentralblatt für Volksbildungswesen, 8. Jg., Nr. 9-10, S. 10. Dezember 1908, S. 129-142. Oskar Maurus Fontana, Wiener Freie Volksbühne. In: Die Wage, 13. Jg., Nr. 46. Stefan Großmann, Ich war begeistert, Berlin 1930. Josef Luitpold Stern, Wiener Volksbildungswesen, Jena 1910, S. 93-98.
4 Oskar Maurus Fontana, Volkstheater Wien, S. 14.
5 Ebda., S. 17.
6 Vergleiche Tabelle bei: Axel Teichgräber, Das „Deutsche“ Volkstheater und sein Publikum. Wien 1889 bis 1964. Ein theaterwissenschaftlicher Beitrag zur Morphologie des Publikums an Hand der Spielplananalyse eines kontinuierlich geführten Wiener Theaters, Diss. Univ. Wien 1965, S. 139 f.
7 Neben der „Sozialdemokratischen Kunststelle“ war noch die „Kunststelle der öffentlichen Angestellten“ für das Volkstheater in der Abnahme großer Kartenkontingente von Bedeutung. Die „Kunststelle des Zentralrates der geistigen Arbeiter“, die „Deutsche Kunst- und Bildungsstelle“ und die „Kunststelle für christliche Volksbildung“ hatten demgegenüber nur marginale Bedeutung. Alfred Pfoser, Konjunktur und Krise. Zur Sozial- und Kulturgeschichte eines Theaters. In: Evelyn Schreiner (Hrsg.), 100 Jahre Volkstheater. Theater, Zeit, Geschichte, Wien/München 1989, S. 37 f. Susanne Fröhlich, Kulturpolitik 1888/89-1938 und ihre Auswirkungen auf Inszenierungen im Wiener Burg- und Volkstheater (Geschichte und Werkanalyse), Dipl.-Arb. Univ. Wien 1994, S. 73 f.
8 Horst Jarka, Fallstudie: Theater für eine „Jugend in Gefahr“. In: Franz Kadrnoska (Hrsg.), Aufbruch und Untergang. Österreichische Kultur zwischen 1918 und 1938, Wien-München-Zürich 1981, S. 579-586.
9 Walter Sorell, Heimat Exil Heimat. Von Ovid bis Sigmund Freud. Mit einem Vorwort von Hubert Ch. Ehalt (= Wiener Vorlesungen im Rathaus, Bd. 53), Wien 1997, S. 11 und S. 20. Wilhelm Filla, Wissenschaft für alle – ein Widerspruch?. Bevölkerungsnaher Wissenstransfer in der Wiener Moderne. Ein historisches Volkshochschulmodell (= Schriften des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen, Bd. 11 Edition Volkshochschule), Innsbruck-Wien-München 2001, S. 670 und Anmerkung 31 auf S. 676 f. Walter Sorell, Die Stimme des Wortes/The Voice of the Word. Betrachtungen eines Neunzigjährigen/Reflections of an Nonagenarian. Hrsg. von/ed. by Harry Zohn (= Austrian Culture, Vol. 28), New York-Washington DC-Baltimore-Boston-Bern-Frankfurt am Main-Berlin-Vienna-Paris 1998.
10 Zum Volkstheater im Nationalsozialismus vergleiche: Helene Stürzer, Acht Jahre Deutsches Volkstheater 1932-1939, Diss. Univ. Wien 1942. Petra Rosar, Das Deutsche Volkstheater als NS Unterhaltungstheater von 1938-1944, Dipl.-Arb. Univ. Wien 2001. Evelyn Deutsch-Schreiner, Nationalsozialistische Kulturpolitik in Österreich von 1938-1945. Unter spezieller Berücksichtigung der Wiener Theaterszene, Diss. Univ. Wien 1981. Alfred Hager, Krieg und Theater. Nach den Spielplänen der Wiener Bühnen von 1938-1944, Diss. Univ. Wien 1950. Hilde Haider-Pregler, Das Dritte Reich und das Theater. In: Maske und Kothurn. Internationale Beiträge zur Theaterwissenschaft, 17. Jg., Heft 3, Wien 1971, S. 203-214. Rainer Hirschkorn, Die Dramatiker am Wiener Volkstheater 1939-1945. Ausgangspunkt einer Analyse zur Kontinuität kultureller Eliten und inhärenter Tradierungstraditionen, Diss. Univ. Wien 1994. Oliver Rathkolb, Führertreu und gottbegnadet. Künstlereliten im Dritten Reich, Wien 1991, S. 162 ff.
11 Oliver Rathkolb, Die „zahmen“ wilden Fünfziger Jahre. Einige Überlegungen. In: Evelyn Schreiner (Hrsg.), 100 Jahre Volkstheater. Theater, Zeit, Geschichte, Wien-München 1989, S. 201. Wilhelm Pellert, Roter Vorhang. Rotes Tuch. Das Neue Theater in der Scala (1948-1956), Wien 1979. Carmen Renate Köper, Ein unheiliges Experiment. Das Neue Theater in der Scala (1948-1956), Wien 1995. Carmen Renate Köper, Frauen am Neuen Theater in der Scala. Wenig Lohn für großes Engagement. In: Hilde Haider-Pregler/Peter Roessler (Hrsg.), Zeit der Befreiung. Wiener Theater nach 1945, Wien 1998, S. 187-211. Zu diesbezüglichen autobiographischen Erinnerungen vergleiche: Otto Tausig im Gespräch mit Susanne Gföller, Von Humanismus und Demokratie und was daraus wurde. In: Hilde Haider-Pregler/Peter Roessler (Hrsg.), Zeit der Befreiung. Wiener Theater nach 1945, Wien 1998, S. 396-416.
12 Oliver Rathkolb, Die „zahmen“ wilden Fünfziger Jahre. Einige Überlegungen. In: Evelyn Schreiner (Hrsg.), 100 Jahre Volkstheater. Theater, Zeit, Geschichte, Wien-München 1989, S. 199 f. Allgemein: Gerhard Jagschitz/Klaus-Dieter Mulley (Hrsg.), Die „wilden“ fünfziger Jahre. Gesellschaft, Formen und Gefühle eines Jahrzehnts in Österreich, St. Pölten-Wien 1985. Reinhold Wagnleitner, Coca-Colonisation und Kalter Krieg. Die Kulturmission der USA in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg (= Österreichische Texte zur Gesellschaftskritik, Bd. 52), Wien 1991.
13 Kurt Palm, Vom Boykott zur Anerkennung. Brecht und Österreich, Wien-München 1983. Kurt Palm, Brecht und Österreich. Anmerkungen zu einigen Auseinandersetzungen um Brecht in den fünfziger Jahren. In: Friedbert Aspetsberger/Norbert Frei/Hubert Lengauer (Hrsg.), Literatur der Nachkriegszeit und der fünfziger Jahre in Österreich (= Schriften des Institutes für Österreichkunde, Bd. 44/45), Wien 1984, S. 128-138.
14 Kurt Palm, Vom Boykott zur Anerkennung, S. 93 und 96 f.
15 Johannes Sachslehner, „Ein dekadenter Literat“. Der Horváth-Skandal 1948. In: Hilde Haider-Pregler/Peter Roessler (Hrsg.), Zeit der Befreiung. Wiener Theater nach 1945, Wien 1998, S. 176 ff. Evelyn Deutsch-Schreiner, „Von Flottwell zu Valentin“. Das Wiener Volkstheater in der Nachkriegszeit. In: Hilde Haider-Pregler/Peter Roessler (Hrsg.), Zeit der Befreiung. Wiener Theater nach 1945, Wien 1998, S. 171 f.
16 Karin Breitenecker, Es muß gewagt werden. Die Direktion Leon Epp am Volkstheater 1952-1968, Dipl.-Arb. Univ Wien 1991, S. 21.
17 Martina Ondracek, Erlebnis Peripherie. Das Volkstheater in den Außenbezirken im Spektrum der Theaterkonzepte des 20. Jahrhunderts, Dipl.-Arb. Univ. Wien 2001, S. 16.
18 Franz Senghofer, Wie es dazu kam. In: Arbeiterkammer für Wien (Hrsg.), Zehn Jahre Volkstheater in den Außenbezirken, Wien o.J., S. 7.
19 Hans Fellinger, Das Volkstheater in den Außenbezirken – von der Idee zum Erfolg. In: Arbeiterkammer für Wien (Hrsg.), Zehn Jahre Volkstheater in den Außenbezirken, Wien o.J., S. 33.
20 Axel Teichgräber, Das „Deutsche“ Volkstheater und sein Publikum, S. 204 f.
21 Hans Weigel, Das Volkstheater in den Wiener Außenbezirken. In: Friedrich Langer (Hrsg.), Wiener Theaterjahrbuch 1956, Wien/Melk 1956, S. 39 f.
22 Dietrich Hübsch, Kompromissloses Theater gegen Gefühlsträgheit und Wohlstandslethargie. Die elfte Direktion. Leon Epp seit 1952. In: Maske & Kothurn. Vierteljahresschrift für Theaterwissenschaft, 13. Jg., Heft 4, Wien 1967, S. 303.
23 Hilde Haider-Pregler, Direktion Leon Epp. In: Evelin Schreiner (Hrsg.), 100 Jahre Volkstheater, S. 204.
24 Elisabeth Epp, Glück auf einer Insel. Leon Epp – Leben und Arbeit. Wien-Stuttgart 1974, S. 168.
25 Franz Mrkvicka, Bildungs- und Kulturarbeit der Arbeiterkammern. In: Arbeit & Wirtschaft, 6/1979, S. 31 f.
26 Dietrich Hübsch, Kompromissloses Theater gegen Gefühlsträgheit und Wohlstandslethargie, S. 306.
27 Martina Ondracek, Erlebnis Peripherie, S. 8 f.
28 Jean-François Lyotard, Zone. In: Ursula Keller (Hrsg.), Perspektiven metropolitaner Kultur, Frankfurt am Main 2000, S. 119.
29 Jean Baudrillard, Die Stadt und der Haß. In: Ursula Keller (Hrsg.), Perspektiven metropolitaner Kultur, S. 132.
30 Siegfried Mattl, Wien im 20. Jahrhundert, (= Geschichte Wiens, Bd. 6), Wien 2000, S. 80.
31 Interview mit Fritz Sailer am 11. Dezember 1990. Zitiert bei: Karin Breitenecker, Es muß gewagt werden. Die Direktion Leon Epp am Volkstheater 1952-1968, Dipl.-Arb. Univ. Wien 1991, S. 29.
32 Thomas Sieverts, Die „Zwischenstadt“ als Feld metropolitaner Kultur – eine neue Aufgabe. In: Ursula Keller (Hrsg.), Perspektiven metropolitaner Kultur, S. 221.
33 Martina Ondracek, Erlebnis Peripherie, S. 29. Wilhelm Filla, Die Häuser der Begegnung in Wien. Eine Struktur- und Frequenzanalyse für das Arbeitsjahr 1973/74 am Beispiel der Häuser der Begegnung Mariahilf, Döbling und Floridsdorf als Beitrag zur empirischen und theoretisch-sozialwissenschaftlichen Durchdringung der Wiener Volksbildung (= Schriftenreihe des Verbandes Wiener Volksbildung, Bd. 1), Wien 1975. Karl Foltinek, Bauten für die Volksbildung – Beispiele aus Österreich und der Bundesrepublik Deutschland. In: Die Österreichische Volkshochschule, 18. Jg., Heft 66, September 1967, S. 5-14. Gerhardt Kapner, Volksbildungsbauten der Stadt Wien. In: Die Österreichische Volkshochschule, 18. Jg., Heft 66, September 1967, S. 15-18.
34 Karl Schuster, Interview am 27. Oktober 1997. Zitiert bei: Martina Ondracek, Erlebnis Peripherie, S. 62 f.
35 Interview mit Elisabeth Epp, Jänner 1998. Zitiert bei: Martina Ondracek, Erlebnis Peripherie, S. 63.
36 Was heißt und zu welchem Ende finanziert man Volkstheater. In: Die Zukunft. Sozialistische Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur, Heft 20, Oktober 1963.
37 Martina Ondracek, Erlebnis Peripherie, S. 49.
38 Norbert Fahnl, Bildungs- und Kulturarbeit der Arbeiterkammer am Beispiel Wiens, Diss. Univ. Wien 1978, S. 141.
39 Girid Schlögl, Der Theaterkritiker Paul Blaha als Direktor des Wiener Volkstheaters 1979/80-1987, Bd. 1, Diss. Univ. Wien 1994, S. 72.
40 Ebda, S. 11.
41 Karin Breitenecker, Es muß gewagt werden, S. 41.
42 Martina Ondracek, Erlebnis Peripherie, S. 53.
43 Martina Ondracek, Erlebnis Peripherie, S. 50. Franz Mrkvicka, Warum Volkstheater in den Außenbezirken. In: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg.), Applaus. 25 Jahre Volkstheater in den Außenbezirken, Wien o.J., S. 70.
44 Martina Ondracek, Erlebnis Peripherie, S. 49 f.
45 Ebda, S. 53.
46 Bernard Shaw in Stadlau. In: Weltpresse, 7. Jänner 1954. Zitiert bei: Karin Breitenecker, Es muß gewagt werden, S. 37.
47 Gustav Manker, Ein Experiment jubiliert. In: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg.), Applaus. 25 Jahre Volkstheater in den Außenbezirken, Wien o.J., S. 13.
48 Heinz Peyerl, Mit dem Thespiskarren unterwegs ... In: Zehn Jahre Volkstheater in den Außenbezirken. Erfolg einer Kulturellen Aktion der Wiener Arbeiterkammer, Wien o.J., S. 27.
49 Hans Fellinger, Das Volkstheater in den Außenbezirken, S. 45.
50 Zu Leben und Werk Mankers vergleiche: Margit Konschill, Gustav Manker und das Wiener Volkstheater, Dipl.-Arb. Univ. Wien 1999.
51 Renate Wagner, 1969-1979. Direktion Gustav Manker, Ein durch und durch österreichisches Theater. In: Evelyn Schreiner (Hrsg.), 100 Jahre Volkstheater, S. 293.
52 Zitiert bei: Margit Konschill, Gustav Manker und das Wiener Volkstheater, S. 54.
53 Martina Ondracek, Erlebnis Peripherie, S. 21 f. Sibylle Fritsch, Ein Schwank für Jedermann. Das Wiener Gemeindehoftheater führt Heinz R. Ungers politisches Volksstück „Senkrechtstarter“ auf. In: Profil, Nr. 21, 25. Mai 1987.
54 Bildtelegraf, 4. Mai 1955.
55 Arbeiter-Zeitung, 25. September 1970.
56 Arbeiter-Zeitung, 25. September 1970, Zitiert bei: Margit Konschill, Gustav Manker und das Wiener Volkstheater, S. 62.
57 Kurier, 29. September 1972. Zitiert bei: Margit Konschill, Gustav Manker und das Wiener Volkstheater, S. 65 f.
58 Norbert Fahnl, Bildungs- und Kulturarbeit der Arbeiterkammer, S. 143.
59 Volksstimme, 18. September 1976. Zitiert bei: Margit Konschill, Gustav Manker und das Wiener Volkstheater, S. 69.
60 Kronen Zeitung, 7. März 1977. Zitiert bei: Margit Konschill, Gustav Manker und das Wiener Volkstheater, S. 41.
61 Wilhelm Filla, Theater in der Volkshochschule. In: Die Österreichische Volkshochschule, 28. Jg., Heft 106, September 1977, S. 84 f.
62 Norbert Fahnl, Bildungs- und Kulturarbeit der Arbeiterkammer, S. 135.
63 Sigrid Löffler, Das Gold unter dem Trümmerfeld oder: Wiener Spurensuche in den achtziger Jahren. In: Evelyn Scheiner (Hrsg.), 100 Jahre Volkstheater, S. 327 f.
64 Girid Schlögl, Der Theaterkritiker Paul Blaha als Direktor des Wiener Volkstheaters 1979/80-1987, Bd. 1, S. 76 ff.
65 Erwin Kisser, Eine Komödie zum Gruseln. Volkstheater: „Der Himbeerpflücker“ jetzt im Haupthaus. In: Volksstimme, 25. März 1986.
66 Was ist obszön am „Frieden“? Das Wiener Volkstheater nimmt das Hacks-Stück aus dem Abonnement. In: Volksstimme, 21. Februar 1986. „So eine Schweinerei“. Skandal um Hacks „Frieden“ im Volkstheater. Sowie „Adabei“. In: Neue Kronen-Zeitung, 20. Februar 1986. Volkstheater nimmt „Frieden“ aus dem Abonnement. In: Die Presse, 20. Februar 1986.
67 Gratisfahrten vom Rand ins Volkstheater. In: Kurier, 6. Oktober 1987.
68 Franz Endler, Wer hat sich da verändert? Volkstheater-Außenbezirke: „Draußen ...“. In: Neue Kronen-Zeitung, 6. Oktober 1987.
69 Walter Göhring, Bildung – Arbeit – Fortschritt. Bildungs- und Kulturarbeit am Beispiel der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (= Schriftenreihe des Institutes zur Erforschung der Geschichte der Gewerkschaften und Arbeiterkammern, Bd. 12), Wien 2000, S. 196.
70 Edda Kutschera, Blick in den Zuschauerraum. In: Bühne, Nr. 1, Jänner 1988.
71 Alfred Schleppnik, Vom Stellenwert des Modells „Unterhaltung mit Haltung“. In: Walter Göhring, Bildung – Arbeit – Fortschritt, S. 318 f.
72 Christina Kleiser, Kulturelle Erinnerungsarbeit in Österreich nach 1945. Am Beispiel einer szenischen Lesung des Theaterstücks WOLKEN.HEIM von Elfriede Jelinek anlässlich des österreichischen Nationalfeiertages 1999 am VOLKSTHEATER WIEN, Dipl.-Arb. Univ. Wien 2000, S. 95 ff.
73 Zitiert bei: Sibylle Fritsch, Lust am Risiko. Emmy Werner beginnt mit ihrem Volkstheater den anderen Bühnen den Rang abzulaufen. In: Profil, Nr. 6, 8. Februar 1993.
74 Monika Mertl, Testprogramm. Nach fünf Monaten Direktionszeit zog Emmy Werner eine erste Bilanz. In: Bühne, Nr. 366, März 1989.
75 Interview mit VT-Chefin Emmy Werner: Wenn der Staat nicht will ... In: Volksstimme, 11. April 1990.
76 Ditta Rudle, Es soll gelacht werden. Das Volkstheater in den Außenbezirken muß den Bildungsbart abrasieren. In: Wochenpresse, Nr. 37, 13. September 1990.
77 Barbara Petsch, Hoffen auf schrittweise Reform. Frank Michael Weber wird neuer Leiter der „VT-Außenbezirke“. In: Die Presse, 12. Juni 1992.
78 Martina Ondracek, Erlebnis Peripherie, S. 28.
79 Stadt Wien rettet die Außenbezirks-Tournee des Wiener Volkstheaters. In: Die Presse, 6. Juni 2001. Mehr Frauen in Führung. Volkstheater: Beinahe totgesagte Theater in den Bezirken leben auf. In: Kurier, 6. Juni 2002.
80 Antonio Fian, Armut riecht anders als Filz. In: Der Standard, 22. November 2000.
(Wortwahl, Grammatik und Zeichensetzung entsprechen dem Original. Offensichtliche Schreibfehler wurden korrigiert. Ausdrücke in runder Klammer stehen auch im Original in runder Klammer. Auslassungen des Verfassers bei zitierten Quellentexten werden mit […] gekennzeichnet. In eckigen Klammern stehen auch die Seitenzahlen des Originaltextes.)