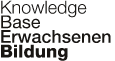Die Bildung von Demokraten – Thesen zu Bildung und Politik (Referat bei der KEBÖ-Jahrestagung 2011)
Full display of title
| Author/Authoress: | Schuh, Franz |
|---|---|
| Title: | Die Bildung von Demokraten – Thesen zu Bildung und Politik (Referat bei der KEBÖ-Jahrestagung 2011) |
| Year: | 2011 |
| Source: | Die Österreichische Volkshochschule. Magazin für Erwachsenenbildung, 62. Jg., 2011, H. 242, S. 3-10. |
[S. 3] Sehr geehrte Damen und Herren, würde ich mir ein Thema aussuchen, das nichts als ein Problem darstellt, ein Thema, das wie eine Falle ist, in die man geht oder läuft, dieses Thema hieße: „Die Bildung von Demokraten.“
Das liegt daran, dass sowohl Bildung als auch Demokratie nicht nur vom Zufall, sondern von ihrer Sache her, will man diese nicht dogmatisch begrenzen, etwas Krisenhaftes und nicht hundertprozentig Eindeutiges haben. Was unter Demokratie verstanden werden soll, damit keine Fisimatenten gemacht werden, habe ich in meiner Jugend gelernt, als Amerikaner ihren Krieg in Vietnam begründeten, als sie ihn zu legitimieren versuchten: Sie wollten die Demokratie bringen.
Früher, nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Brecht die amerikanische Demokratie, die man im Westen Deutschlands für sich zu adaptieren gedachte, angegriffen, indem er die Wortfügung „Freiheit und democracy“ mit den auf der Welt am tiefsten heruntergezogenen Mundwinkeln der Verachtung ausgesprochen hat. In „Der anachronistische Zug“ heißt es zum Beispiel: „Planer der Vernichtungslager/fordern auch für die Chemie/ FREIHEIT UND DEMOCRACY.“
Und heute? Der Soziologe Kurt Imhofer hat mit ein paar Sätzen unser ganzes Thema abgehandelt: „Es gilt“, sagt er, „zivilisatorische Errungenschaften zu verteidigen. Hierzu [S. 4] gehört zuvorderst, dass die Demokratie von der sanften Gewalt des besseren Arguments lebt. In den Fluten des human interests und in der Emotionalisierung und Personalisierung des Politischen verliert diese sanfte Gewalt ihre Chance.“ Es ist das Merkwürdige an dem, was ja viele unter Demokratie verstehen – es gibt sie in dem Sinne nicht, dass sie da ist und man seine Ruhe hat: Demokratie muss man immer wieder herstellen, und die Feinde der Demokratie wechseln. Während man noch ihre alten bekämpft, kooperiert man vielleicht schon mit ihren neuen.
Vor vielleicht fünfzehn Jahren hätte man einen Vortrag zur Bildung von Demokraten leichter halten können. Allein der Grund, aus dem ich ein Demokrat sein möchte, ist für mich derselbe geblieben. Zunächst, weil die Demokratie, so wie ich sie in verschiedenen Ländern beobachtet habe, eine Ablösung der Herrschaft, die Ablösung der Leute an der politischen Macht ermöglicht, ohne dass man sie töten muss. Das wird schon bei verschiedenen Formen der „gelenkten Demokratie“ nicht mehr gehen. Aber die österreichische Demokratie hat in dieser Hinsicht auch ihre Defekte. Wenn Demokratie bedeutet, dass Regierung und Opposition einander ohne Blutvergießen abwechseln, dann konnte man in Österreich wählen, was man wollte, das sozialpartnerschaftliche System erlaubte die Wiederkehr der Gleichen mit leicht verschobenen Akzenten. Deshalb, aus diesem Grund, wollte ich kein Demokrat sein.
Der zweite Grund, warum ich doch ein Demokrat sein möchte, ist noch heikler. In der Demokratie nämlich ist der meines Erachtens hoffnungslose Streit der Menschen um die Wahrheit, der Streit darum, was denn (für alle) das eigentlich Richtige sei, verschoben, abgeschoben auf das Abzählen von Stimmen. Die Zahlen – sie helfen mit ihrer Brachialgewalt dabei, dass sich die Menschen die Köpfe weniger einschlagen, als sie es zum Beispiel für Religionen tun, die es ohne die ganze Wahrheit nicht machen. Aber wir wissen, Zahlen können gefälscht werden, nicht nur vom Präsidenten Bush, der, was er nun mal gewesen ist, durch ein nicht ganz geklärtes Auszählverfahren wurde. Auch ein Bürgermeister, ich glaube in Burgenland, korrigierte ein Wahlergebnis.
Aber ich will den für mich wichtigsten Grund, warum ich gerne ein Demokrat sein möchte, nicht aussparen, obwohl er etwas peinlich, mindestens leicht sentimental ist. Politik, wenn sie diese welthistorisch verankerte ungeheuer kreative, aber auch destruktive Kraft der Menschheit entfaltet, Politik hängt tatsächlich auch immer mit einer scharfen Bestimmung zusammen, wer denn der Feind ist. Das Feindbewusstsein vermochte zwar auch nix gegen viele Arten der Freunderlwirtschaft, aber damit war man wohl näher an der conditio humana, am Wahrhaftigen unserer so unterschiedlich gelebten Existenz.
Die Demokratie, wie ich sie verstehe, mildert die heroische Politik der Feindortung und Feindbekämpfung: Sie mildert die Politik. Es ist ein System, in dem einerseits ein Ausgleich zwischen Individuum und Gesellschaft nicht ganz unmöglich ist. Anderseits aber scheint die Demokratie ein System zu sein, wo über checks and balances verschiedene Gesellschaftsgruppen, die einander sogar wie Feinde hassen, freiwillig eine Gesellschaft bilden können. Es ist ein System, das über die persönlichen Möglichkeiten hinaus, ein Verständnis füreinander (für das voneinander Abweichende) verankert hat. Ohne Sympathie, aber dennoch in manchem am gleichen Strang ziehen ...
Natürlich sind die Menschen, die in einem so ausgeglichenen, abgeklärten Paradies leben, keine ehernen Charaktere, gar keine Übermenschen, die den Menschen und das Allzumenschliche in sich überwunden haben. Sie sind eher Menschlein, „Systemtrottel“ wie sie Besserwissende nennen, und auch wenn der Friede, den sie, die mit ihren Nachbarn auf Mord und Brand streiten, mit der Welt geschlossen haben, faul ist, egoistisch, weltabgewandt, so hat die Demokratie es doch – salem/shalom – mit Frieden auf Erden zu tun.
Warum es vor fünfzehn Jahren leichter gewesen wäre, über Bildung und Demo-kratie zu sprechen? Na ja, weil heute in die sogenannte „Westliche Demokratie“ schwere Wunden geschlagen sind. Europa, sagte jüngst Peter Weibel, in einer seiner Rollen, nämlich als Eventorganisator, also sogenannter „Kurator“, Europa sei müde und erschlafft. In Europa sähen die Leute der Demontage der Demokratie zu und niemand empöre sich. In den arabischen Ländern riskieren Menschen massenhaft ihr Leben, um die Diktatoren loszuwerden. Die österreichische Variante der Auflösungserscheinungen, der Demontage von Demokratie will ich hier nicht erwähnen, ein Vortrag ist ja keine Unterhaltungssendung.
Ich kenne es aus England: eine beinharte Gesellschaft, die viele Menschen ausgegrenzt hat, die vielen dieses demokratische Prinzip der Partizipation unmöglich gemacht hat – und über diese Basis hat sich wie ein böser und lächerlicher Gott die Unterhaltungsindustrie gelegt. Die Probleme der Kokainnasen beschäftigen Tag und Nacht die gelenkte und die ablenkende Öffentlichkeit.
Die schlimmste Wunde der Demokratie hat ihr aber die Ökonomie geschlagen. Das war immer schon ein Kennzeichen unserer Art von Demokratie, dass ihre Frohbotschaft stets von ihrer Wirtschaftlichkeit eingehegt, umzäunt war. Die Ökonomie hat sich schließlich die Politik untertan gemacht. Dafür sind die Finanzmärkte, die ganze Staaten vor sich her jagen, anthropomorphisiert, vermenschlicht: Sie haben eine Stimmung, man muss sie ständig beruhigen, wie einen bissigen, aufgeregten Hund. Die Verhältnisse erzeugen den Mythos ihrer Unentrinnbarkeit und auch die Besten im Lande sind besorgt. Zur Eröffnung des Brucknerfests hielt Ludwig Adamovich eine großartige Festrede, und ich, obwohl ich die einheimische Art der Nicht-Beachtung des wirklich Wichtigen beinahe nur noch gelassen studierte, bin sprachlos über das (nur hin und wieder linkisch unterbrochene) Schweigen zur Rede von Adamovich, die den Titel trug: „Das Unbehagen in der Demokratie.“
Ich lese seine Rede aber auch unter dem Titel: Das Unbehagen an der Demokratie. Arrogant – von mir, nicht von Adamovich – gesagt, leben die Leute weit unter dem intellektuellen und moralischen Niveau, das die Demokratie, damit sie funktionieren kann, erfordert. „Es gibt zwar“, sagt nun Adamovich, „kein Patentrezept, wohl aber ein wirksames Medikament dagegen. Es lautet Bildung, Bildung und noch einmal Bildung. Die Demokratie setzt den mündigen und verantwortungsbewussten Bürger voraus. Den wieder kann es nur geben, wenn entsprechende Bildung stattgefunden hat.“
Im Folgenden werde ich über Bildung, also auch über das Problematische an ihr sprechen, genauer über Details, die ich für grundlegend halte, damit man die Utopie des Demokratischen nicht so leicht vergessen kann. Ich werde nicht von Bildungsinhalten sprechen, zum Beispiel nicht von der Selbstverständlichkeit, dass ökonomisches, historisches und politisch-juristisches Wissen gelehrt werden muss. Das übernimmt ja dankenswerterweise die Diskussion nach dem Mittagsbuffet. Ich werde – gleichsam verkehrt – auch von einer seltsamen Sache [S. 5] sprechen, nämlich von der Bildungsskepsis Gebildeter. Und alles – selbstverständlich – mit dem sträflichen Makel der Unvollständigkeit.
Eines Tages, sehr geehrte Damen und Herren, bei einem kultivierten Anlass, unterhielt ich mich mit einer Dame, und sie sprach dabei den Namen Schopenhauer aus. Ich antwortete auf der Höhe dieser Aussprache und die Dame geriet darüber ins Entzücken. Endlich jemand, mit dem man sich über Schopenhauer verständigen kann. „Ich wollte“, sagte die Dame, „Schopenhauers Grab besuchen.“ Wo sich dieses denn befände, fragte ich, an Gräbern stets interessiert. Schopenhauer, erfuhr ich, sei in Weimar begraben. „Na“, sagte ich, „bei der Konkurrenz, die er dort als Toter hat, werde ich ihn sicher bald besuchen.“
Übrigens weiß ich, dass von fünf ICE-Zügen nur mehr einer in Weimar hält, und dass die Führung der deutschen Bahn daran denkt, im Jahr 2017 überhaupt keinen ICE mehr in Weimar halten zu lassen. „Uns fehlen drei Minuten“, sagt ungerührt der Chef der deutschen Bahn, und ein Spendenaufruf „Spenden Sie drei Minuten für die deutsche Bahn“, wie in der Sendung „Kulturzeit“ vorgeschlagen, scheint angebracht. Sonst liegt Weimar demnächst an einer deutschen Nebenstrecke.
Natürlich ist Schopenhauer in Frankfurt begraben, aber was macht es? Für einen gelungenen Smalltalk verkaufe ich meinen ganzen Schopenhauer. Die Bildung ist ein rutschiges Gelände, und die Frage, wann ein Missgriff in ihr sträflich ist, gehört zu den peinlichen Bildungsfragen. Ich behaupte, ein Missgriff ist dann sträflich, wenn das Prätentiöse der Bildung plötzlich die bloße Einbildung von der eigenen Klugheit offenlegt. Das hat mit einer Art Göttlichkeitsanspruch zu tun, Sie hören recht, auch Bildung stammt „letzten Endes“ aus der theologischen Sphäre, auch dieser Begriff hat eine theologische Wurzel. Der „eingebildete Gott“ würde religionskritisch klingen und außerdem genauso missverständlich sein wie der berühmte „eingebildete Kranke“, bei dem es sich ja um einen eingebildeten Kranken, also um einen nicht wirklich Kranken handelt.
Theologisch spricht man von „Bildung als Einbilden Gottes in die Seele des Menschen“. So hat die Bildung Priester, und wenn ein Priesterbetrug auffliegt, ist das keine Kleinigkeit. Es ist auffällig, dass die deutschsprachige Öffentlichkeit noch in den fünfziger oder sechziger Jahren die Geißelung Ungebildeter aus den Unterschichten vorsah, eine Art Operettenhohn, festgemacht an Figuren, die Fremdwörter falsch, also komisch aussprechen. Das war widerlich, und heute ist die Unbildung salonfähig. Da hat die Kulturindustrie ganze Arbeit geleistet. Man kann doch nicht mündige Konsumenten, bloß weil sie selbstverschuldet blöd sind, aus der ewigen Wiederkehr von Angebot und Nachfrage ausschließen. Die moderne, die sogenannte liberale Demokratie ist im Positiven keine Erziehungsdiktatur und im Negativen ist sie der Schutzschirm auch für alle, die gerne vertrotteln. Sie dürfen das, und ich glaube, Churchill war es, der als größten Einwand gegen die Demokratie genannt hat, fünf Minuten Unterhaltung mit einem Wahlberechtigten.
In Deutschland, so habe ich es in einer Diskussion gehört, gäbe es derzeit sieben Millionen Analphabeten. In Parallelität zu den Einkommensverhältnissen koppelt sich also auch bildungsmäßig eine Oberschicht von einer sogenannten Unterschicht ab – während man in der Mitte sich weniger nach oben durchkämpft, sondern mehr damit ringt, nicht abzusinken. Es spaltet sich die Gesellschaft, wie es im Jargon heißt, in „informierte Leistungsträger“ und in die, die nicht einmal eine Zeitung lesen können, und die, wenn sie’s könnten, auch davon nichts mehr hätten. Sie sind in großer Zahl aus der Gesellschaft ausgetreten und werden in der Hauptsache nur noch verwaltet und vom Privatfernsehen amüsiert: Hartz IV und RTL, natürlich auch RTL II und Super-RTL, geschweige denn Sat 1, um von Pro 7 nicht zu reden.
Nein, die Leistungen der Leute, die das Arbeitslosengeld für andere durch ihre Steuern aufbringen, sind nicht gering zu schätzen, selbst wenn es zu wenig Geld wäre. Wenn es aber Hartz IV sich zu einer Abschlagszahlung dafür entwickelt, dass die sogenannten Empfänger in einer separaten Kultur verstaut werden und an der Allgemeinheit (zum Beispiel an Bildungseinrichtungen) nicht mehr teilnehmen, dann wird’s auch demokratiepolitisch fraglich. Die, um es nobel auszudrücken, „Missverhältnisse in der sozialen Balance“ sind ein Grund, auf dem die Demokratie, die keine Erziehungsdiktatur ist, und die auch das Recht auf Nicht-Bildung garantiert, sich zumindest tendenziell selbst aufhebt (oder vernichtet). Die Einführung der Diktatur, steht bei Brecht, kann zur Demokratie führen, die Einführung der Demokratie zur Diktatur.
In diesem Zusammenhang ist es, selbst wenn es unmittelbar nur einen kleinen, eingeweihten Kreis betreffen sollte, eben nicht immer eine Privatsache, über die andere Privatleute sich einfach lustig machen können, wenn ein Bildungspriester sich als Nebochant verrät (oder wenn ein Guttenberg die Doktorarbeit zum bloßen Insignium einer Politikerkarriere herabwürdigt). Altmodisch und nicht theologisch gedacht, gibt ein gebildeter Mensch ein Vorbild ab, und das gibt er ab, also er desavouiert es, wenn er enttarnt wird. Ich finde, um es an einem Beispiel anschaulich zu machen, Fritz J. Raddatz, der einmal/einst – neben Marcel Reich Ranicki – als Literaturpapst gehandelt wurde, hat, nein – nicht zurecht seine Strafe bekommen. Zu Unrecht aber auch nicht. Die Strafe, nämlich die Entlassung aus seiner Position als Feuilletonchef der ZEIT, war einfach unvermeidlich. Der verdiente Feuilletonchef hatte, wenn ich mich recht erinnere, aus einem satirischen Artikel der „Neuen Zürcher Zeitung“ abgeschrieben und die satirische Absicht überlesen. Er hat sie einfach nicht bemerkt. So schrieb Raddatz dann in seinem eigenen Blatt was von Goethe, der sich im anrüchigen Frankfurter Bahnhofsviertel herumtrieb.
Goethe ist bildungsmäßig immer gefährlich, auch wenn es zu seiner Zeit gar kein Bahnhofsviertel gab, geschweige denn ein anrüchiges, in dem man sich gar als Goethe herumtreiben konnte. Und Raddatz wiederum ist ein Mann von Haltung – wie er mit seinen achtzig Jahren, Strohhut auf, elegantester Anzug an, ein weißer Zweireiher, dem Fernsehen ein Interview gibt – das ist das Zitat einer Größe, einer durch Bildung untermauerten Größe, die heute keiner mehr hat. Was kann man mehr tun, als so eine Größe zu zitieren, das heißt sie wenigstens als heute unmöglich darzustellen, sie durch eine höchstpersönliche Inszenierung deutlich überholt vor Augen zu führen? Der Zuschauer dankt immerhin für die Mühe.
Es ist gut, dass der deutsche Feuilleton Fritz J. Raddatz wieder anerkennt, ja, dass es sich anhand von dessen jüngst erschienenen Tagebüchern selbst feiert, nämlich die eigene Fehlerhaftigkeit, diese Verkommenheit, die im besten Fall, wie bei Raddatz, elegant, ironisch, selbstironisch, und nicht zuletzt verquält, leidend auftritt – jedoch immer hochintelligent und äußerst sensibel – und gebildet.
Es ist also kein Wunder, dass es gebildete Verächter der Bildung gibt. „In einen hohlen [S. 6] Kopf geht viel Wissen“, hat Karl Kraus gesagt, und das ist traditionelle Kritik an der Gelehrsamkeit. Wenn Bildung nicht inspiriert ist, wenn ihr der Funke fehlt, dann hat Bildung etwas Totes. Sie wird dann auch schnell zur Rache am Leben. In Finnland gibt es eine festgeschriebene pädagogische Maxime, die da lautet: „Kein Kind darf beschämt werden“.
Als ich davon hörte, fiel mir der Lateinprofessor Pospisil ein, ein Mann, der sein Haar zurückgekämmt trug mit Ausnahme einer grauen lockenartigen Haarsträhne, die seinem Kopf etwas Wagemutiges verlieh. Er beschämte, was es in der Klasse zu beschämen gab und er bereicherte von Stunde zu Stunde die Scham derer, die schon beim letzten Mal versagt hatten. Sie, die schon gezeichnet waren, kamen zuverlässig wieder dran, und da dieser Professor pro Unterrichtsstunde länger prüfte als unterrichtete, wuchs auch die Zahl der Versager.
Aber ich füge hinzu, dass Pospisils System für die, die dadurch nicht zur Strecke gebracht und ausgemustert wurden, funktionierte: Man war für die Jahre nach Pospisil firm in Latein – und das ist die Ausrede, mit der die letzten Reste der Schwarzen Pädagogik zu meiner Schulzeit noch verteidigt wurden. In der Pause gerade noch lebendig standen die Kinder und später die Jugendlichen ängstlich und zerdrückt einem Pospisil gegenüber, der sich seiner Erfolge durch Unterdrückung und Angstmache sicher sein konnte. Er genoss, wie das Leben aus den Versagern wich und wie die anderen, die in seiner harten Schule durchkamen, reüssierten. Angst als Erziehungsmittel, Angst als Mittel in der Bildung junger Menschen, ist per se das Gegenteil der Bildung von Demokratie. Demokratie setzt voraus, dass man – auch zu ihrer höheren Ehre – freimütig sprechen lernt.
Folgt man Anneliese Rohrer, dann ist die Einübung eines solchen demokratischen Verhaltens heute genauso die Ausnahme wie in meiner Schulzeit. Die meisten jungen Menschen, so Rohrer, „wurden und werden in einem Bildungssystem sozialisiert, in dem Kritik, Hinterfragen, Skepsis, Infragestellen nur in seltenen Fällen – entweder durch die ,Unternehmenskultur‘ einer bestimmten Schule oder durch die Aufgeschlossenheit individueller Pädagogen – erwünscht und gefördert werden. Lob und Ermunterung für unruhige Verhaltensweisen sind selten. Angepasstheit und Schweigen sind der weitaus höhere Wert. Wenn sie dann in die reale Welt ,entlassen‘ werden, betreten sie diese ohne das entsprechende Handwerkszeug, ohne Übung, ohne Technik im kritischen Diskurs. Eine eigene Meinung mit Argumenten abzusichern, erfordert Training, Zuspruch und die Aufforderung zu Mut.“
In einem System der Entmutigung ist die eigene Meinung ein Ereignis. Sie ist die Ausnahme von der Regel, und sie wird gegen die Regel mit allerhand Redensarten propagiert, im Konfliktfall aber, wenn die Meinung der Regel widerspricht, wird sie marginalisiert. Die Pospisil-Pädagogik erzeugt eine angstlüsterne Faszination, eine immerwährende Konzentration auf das, was man nicht schafft und auch das Gelingen ist stigmatisiert: Es wird einem als ein triumphales Nicht-Scheitern antrainiert und schließlich auch so, nämlich als Vermeidung der Niederlage, empfunden. Diese Pädagogik hat sich tief in die Kultur eingegraben, die sich mit Maximen wie „Scheitern, besser Scheitern, am besten Scheitern“ selbst feiert. Das freimütige Sprechen ist Voraussetzung für einen demokratischen Diskurs, weil Kritik nur an Sätzen sinnvoll ist, die tatsächlich einer Meinung entsprechen, sodass sich an ihnen der Meinungsstreit, in dem es wirklich um etwas geht, entwickeln kann.
Aber das ist – wie auch Rohrers zutreffende Polemik – nur Programm, nur eine allgemeine Richtlinie. Wie man so ein Programm realisiert, steht auf einem anderen Blatt. Wie unterrichtet man Skepsis, ohne dass sie selbst wie jede beliebige Dogmatik von den Schülern abverlangt, abgeprüft wird? Kritik zum Beispiel wird ebenfalls schnell ein Fetisch, wird schnell zu einer im Kern unkritischen Attitude. Ich habe den Unterrichts- und Kunstminister nicht vergessen, der in der Eröffnungsrede zu den Salzburger Festspielen eine kritische Kunst verlangte. Eine kritische Kunst müsste sich aber nicht zuletzt gegen den Eröffnungsredner selbst richten, wodurch sein Aufruf zur Kritik in den Rang einer pathologischen Kommunikation gerät – nach dem Muster: Wann endlich werdet ihr euch gegen mich durchsetzen?
Ähnliche Probleme durch Selbstbezüglichkeit (also dadurch, dass man den Inhalt einer Behauptung auf die Behauptung selbst anwendet) gibt es beim freimütigen Sprechen. Eine Glosse in der FAZ, und später zu einem Aufsatz ausgearbeitet, hat das unter dem Titel „Sprachennot und Parrhesie“ diskutiert. Parrhesie – Foucault hat dem Thema seine letzte Vorlesung gewidmet – ist eine antike Tugend, eben die des Muts zur Wahrheit. Parrhesie bezeichnet die Freiheit oder die Möglichkeit „alles zu sagen“. Das ist eine der Grundvoraussetzungen des Diskurses, den ich demokratisch nennen möchte: dass man mitreden kann, und zwar unverstellt. Man spricht auf dem Niveau, das man eben hat, und man hat keinen Grund zu verschweigen, wer man ist. Man kann „offen“ sein.
Ich habe in meiner Lebenserfahrung unter anderem auch diese zwei Arten von Menschen kennengelernt: solche, die das offene Sprechen provozieren, hervorrufen, ermöglichen und andere, die es – oft mit allen Mitteln – zu verhindern trachten, die eine Aura kultivieren, mit der sie sich undurchdringlich, nicht ansprechbar machen. Ich nannte es – für das private Leben – die Eigenschaft der Güte, wenn man in der Lage ist, einen anderen aus der Befangenheit zu befreien, sodass er freimütig spricht. Ich hänge aber so sehr an der Individualitätskultur, dass ich jedem (auch mir selbst) einräume, abweisend zu sein. Es ist ja ebenfalls eine nötige Kunst, manchen Menschen zum Schweigen zu verhelfen. Das ändert nichts daran, dass die Bildung von Demokraten ohne Übung, ohne Garantie des freimütigen Sprechens nicht denkbar ist.
Ich will zwei Beispiele nennen, die das Undemokratische des gebotenen Schweigens anschaulich machen: Im Spital bin ich einmal hinter dem Primar hergelaufen, der gerade um die Ecke gegangen war. „Wohin des Weges?“, fragte mich die Schwester. Ich antwortete, dass ich den Primar schnell noch etwas fragen möchte. Sie sah mich an, als ob ich verrückt geworden wäre. Der ist doch nicht zu sprechen! Die Hierarchie erlaubt es nicht jedermann, einfach das Wort an den Herrn Professor zu richten, auch dann, wenn er gerade vorüber huscht.
Das ist zwar typisch, aber harmlos und könnte auch praktische Gründe haben. Auf typische Weise nicht harmlos ist das Schweigegebot, das die katholische Kirche zum Beispiel in Amerika jenen Missbrauchsopfern auferlegte, denen sie eine Entschädigung zahlte. Wer den Vertrag unterschrieb, wer das Geld annahm, hatte über den Missbrauch zu schweigen, und das ist in zweierlei Hinsicht wider die guten Sitten der Demokratie: Einerseits akzeptiert einer, der insgeheim Geld nimmt, um dann zu schweigen, dass es bei ihm das Geld ist, das seine Wunden endlich schließt. Andererseits wird mit diesem Schluss dem öffentlichen Diskurs eine Information genommen, die man nötig hat, um zu wissen, was und in welchem Ausmaß los ist. Transparenz lautet der Politikerterminus dafür.
Aus alle dem geht hervor, dass ich erstens dazu neige, Demokratie nicht zuletzt [S. 7] für eine Lebensform zu halten – dass sie also alle Bereiche des Daseins durchflutet. Ich weiß, Demokratie als Lebensform ist eine Formel John Deweys, die in der Auslegung ihres Erfinders für mich auch etwas Ablehnenswertes hat, nämlich die Überbetonung, die Vorherrschaft der Gemeinschaft. Dieses, wie die Katholiken sagen, „Miteinander“, das vorschnell Unter- und Einordnung verlangt, will ich nicht gemeint haben. Ich meine, dass Demokratie als Herrschaftsform nicht ausreicht, vor allem wenn sie schlicht die Herrschaft der Mehrheit über alle anderen meint, wie das der Populismus der „Kronen- Zeitung“ Tag für Tag deklariert und dabei die Mehrheit, an die sie zu appellieren vorgibt, überhaupt erst erzeugt.
Das, was ich zu verteidigen wähne, ist ein Verhaltenskodex, ohne den die real existierende Variante der Demokratie auch nicht ausreichen würde, also die Variante, die mit Gewaltenteilung und Rechtsstaat zum Glück eine komplexe Angelegenheit ist. Ich behaupte, dass es erlernbare Verhaltensweisen gibt, die bei der Bildung von Demokraten wichtig sind: in erster Linie eben die freimütige Rede. Ohne solche Verhaltensweisen, für die im Bildungsbetrieb Voraussetzungen geschaffen werden müssen, vorgesorgt werden muss, würde die Demokratie austrocknen; sie würde zur Wüste ihrer Selbstreproduktion und ihres Machterhalts werden. Es muss aber zwischen solchen Verhaltensweisen, die man gut, also demokratisch heißen kann, und der anderen Definition von Demokratie als einem komplexen System einen politischen Kontakt geben. Sie müssen ins politische System einfließen können, sonst verblieben sie im Moralischen und wären dort abgeschnitten. Axel Honneth sprach, und es klingt fast poetisch, von einem „Kranz von Institutionen“, die einem Bürger in der Demokratie die Freiheit ermöglichen. Man darf also die freimütige Rede nicht als Privateigenschaft im Stich lassen, man muss sich dafür einsetzen, dass sie institutionell, also gesellschaftlich verwendet wird.
Das zweite, zu dem ich neige, ist eben eine zart utopische Denkweise. Das, wovon ich im Grunde rede, gibt es ja Nirgendwo, und wenn es in Ansätzen existiert, dann ist es höchst gefährdet. Deshalb zitierte ich die Glosse „Sprachnot und Parrhesie“, die am Ende zeigt, wie auf signifikante Weise in unserer Art von Gesellschaft auch die freimütige Rede in den täuschenden Mythos, in den Bann der Lüge, eingebaut werden kann, und zwar so: Da man weiß, vor allem in den Wissensbranchen, dass freimütige Rede sein soll (Richtlinie, Programm), entnimmt man ihr Zeichen, die darauf hindeuten, dass man „offen“ ist, also eine solche Rede führt. Die freimütige Rede hat aber einen Hintergrund, eine Voraussetzung, die nicht allein der – politische – Stolz vor Königsthronen ist. Freimütig sprechen, was für eine Bildungsaufgabe!, kann nur der Mensch, der sich in der Sprache zurecht findet, sodass er auf sie hören kann.
Es ist eben nicht bloß dieses Soziologische, sich vorm Stärkeren nicht zu fürchten, sondern es ist auch das Sprachliche, das man verstanden haben muss, um sich frei verständigen zu können. Jürgen Paul Schwindt, der Autor der zitierten Glosse „Sprachnot und Parrhesie“, sieht den Verlust der Bildung, der Bildung, die die Sprache selbstverständlich leisten kann: „Wir haben aufgehört, auf die Winke und Fingerzeige zu achten, die die Sprache selbst gibt. Stattdessen spannen wir sie über die plumpen Leisten, die uns die je geltenden Normen und Konventionen vorzugeben scheinen. Wo wir bisher in der Sprache hineinhorchten und uns am Reichtum der Nuancen und Schattierungen des Ausdrucks erfreuten, hören wir nur mehr den tosenden Hohlraum einer bedeutungsleeren Echolalie: Die Sprache wird zum bloßen Widerhall eines monoton gezimmerten Weltbilds. Die Ideologisierung der Sprache erinnert an die bekannte Weise, wie autoritäre Systeme ihrer Untertanen zu frühmorgendlichen Appellen versammeln, um ihnen Form und Zuschnitt der ,richtigen Rede‘ beizubiegen.“
Das richtet sich an die Gebildeten, ja, an Exponenten des Wissenschaftsbetriebs. Die Absicht dabei ist, den Nachweis zu führen, dass Universitäten nicht mehr sind, was sie sein sollten, nämlich der Ort der freimütigen Rede. Aber die Ideologisierung der Sprache, füge ich hinzu, kennt keine Bildungs- oder Klassenschranken (man kennt das Phäno-men der monoton gezimmerten Weltbilder doch von den Bornierten aller Klassen, Rassen und Religionen), und der Appell ans Sprachdenken, diese Polemik gegen das eingelernte automatisierte Sprechen, war seit eh und je eine Rückversicherung gegen die Reflexe und Reproduktionen simplifizierender Dogmen. Ich meine das – gar nicht im Sinne der zitierten Glosse – strategisch: Intelligenzarbeit beim unvermeidlichen Versuch, die unendliche Vielfalt der Welt (und sei die Welt „nur“ das, was der Fall ist) auf Begriffe zu bringen, reduziert naturgemäß – und für jede dieser Reduktionen gilt der Ideologieverdacht. Hört man im Vortrag seiner jeweiligen Ideologie (oder seines gebastelten Weltbildes) auf die Winke der Sprache, kann man die Möglichkeit, dass der Verdacht richtig liegt, in die eigene Sprache mit einbringen. In der freimütigen Sprache sind auch unsere Irrtümer aufgehoben, eingestanden, und das heißt natürlich nicht zuletzt, dass es frei steht, sie zu kritisieren.
Immunisierung gegen Kritik ist einer der Gründe, warum sich Politiker automatisiertes Sprechen beigebracht haben. Der Wunsch, keinen Fehler zu machen, macht die Sprache unfrei, mechanisch. Wie sehr das der Demokratie schadet, ist heute bereits ein Gemeinplatz: Die Leute können diese Sprache nicht mehr hören! Aber die negative abwehrende Freiheit des Publikums ist nicht schon die Lösung, weil es nämlich denen, die in dieser Negation gefangen sind, genügt, andere Sprechweisen, unabhängig von deren Inhalt zu hören. Was Haider wirklich sagte, als er, der uns nie belog, log, können wir heute wissen. Damals, als er das Wort ergriff, war es für viele wie frischer Wind, in den einige sofort ihr Fähnchen hingen. Heute gilt für sie die Unschuldsvermutung.
Seit der Antike gibt es diese zwei Arten von Rhetorik: Die eine lehrt, einen Gedanken adäquat auszudrücken, das heißt: auch mit der Kraft, die ihm zukommt. Die andere lehrt, mit welchen Tricks man Leute überredet, an etwas zu glauben, woran man selber nicht glaubt. In der ersten Disziplin hängt es davon ab, dass man seinen Gedanken auch selbst denken kann. Für die zweite Disziplin genügt es, dass man mehr oder minder virtuos befolgt, was ein anderer einem vorgesagt hat, man soll es sagen oder nicht sagen. So viel zu Politikberatern, Spin-Doktoren, Mediencoaches – diesen scheinbar notwendigen Wahrzeichen in der Demokratie, die wir haben.
Freimütiges Sprechen ist nur mit einem Mut zur Wahrheit möglich. Wahrheit heißt hier das, was man denkt, sie sei es, und das sollte nicht bloß ein Einfall sein, den man gerade für wahr hält. Denken heißt überlegen, ob das, was man für wahr hält, auch wirklich wahr ist. Und da bin ich wieder bei der Glosse, die die Wahrheitsfrage an die Universitäten stellt. Sollte nicht dieser „unbedingte Mut zur Wahrheit“, fragt der Autor, ein Altphilologe, gerade in den Hohen Schulen gepflegt werden und seine Heimat haben, sollten unsere höheren Bildungsanstalten [S. 8] nicht „das Paradies des parrhesiastischen Aufklärers“ sein, und er antwortet verneinend: „Denn längst haben die Hüter des neuen Idioms sich auch mit den Relikten des alten Freimuts bemäntelt. Großzügig bedient man sich aus dem sprachlichen Repertoire der freimütigen Rede: ,Offen gestanden‘, ,ich gestehe‘, ,bekennen wir gleich‘. Zuweilen scheint es, dass der eingebildete Parrhesiast die Rede des wirklichen Parrhesiasten vorwegzunehmen und dadurch unschädlich zu machen sucht. Die Münze und das Geld des wirklichen Parrhesiasten werden entwertet durch den inflationären Gebrauch der Währung: seiner Begriffe und Vorstellungen. Wie also ist der wirkliche vom eingebildeten Parrhesiasten zu unterscheiden? Und wie finden wir aus dem Teufelskreis sprachlicher Verstellungen heraus?“
Ich möchte daran erinnern, dass ein Strang meiner Überlegungen den erschwerten Umständen gilt, zur demokratischen Tugend des Kritischen zu erziehen. Man kennt die Regel, dass es sein muss, und über die Euphorie, eine Regel zu kennen, nimmt man weniger wahr, wie schwer es ist, sie zu realisieren, ihr Leben zu geben. Jürgen Paul Schwindt, der Autor der Glosse „Sprachnot und Parrhesie“, ist einerseits Professor für Altphilologie, aber andererseits formuliert er ein Problem wie aus dem Katechismus der Post-Moderne: Die postmoderne Welt, so wird über sie gesagt, entzieht sich dem Verständnis der Menschen immer mehr, hinter jeder Bedeutung muss er eine weitere suchen und fürchten, an die wahre nicht heranzukommen. Schwindt ist aber eben auch Altphilologe, das heißt, er weiß schon, wie man an die wahre Bedeutung herankommt:
„Sollte der wirkliche Parrhesiast nicht derjenige sein, der die Sprache genauer fasst? Der aus der freiwilligen Bindung an die Legislatur der Sprache die höchstmögliche Präzision der Darstellung schöpfen kann? Der sich auf den Tanz des gefesselten Bären versteht und so die exakteste Ausführung des Gedankens mit der genauesten Anwendung der Sprache verbindet?
Ich gestehe, dass ich Karl Kraus hier eitel ins Spiel gebracht habe (und noch weiter bringen werde), weil Kraus das Sprachdenken in vorbildlicher, geradezu juristischer Weise betrieben hat, das heißt: inklusive der Verfolgung der Angeklagten, die sich durch ihren Sprachgebrauch nachweislich an der Sprache versündigten. Aber diese Sünden erscheinen im Spiegel des Sprachdenkens nicht als formale Fehlerhaftigkeit, nicht als Gebrauch falscher Wendungen zum Beispiel, wie sie die Sprachpolizei aufdeckt. Das erwiesene Falsche betrügt aus der Perspektive die Gesellschaft um die humanitären Möglichkeiten, die in ihr eventuell noch stecken, oder sie verstärkt die Tendenzen zur Inhumanität, die bereits ausgebrochen ist. Die Sprachkritik des Karl Kraus ist Ideologiekritik, ohne so selber eine Ideologie zu sein, die sich wie üblich mit einer anderen Ideologie misst und sie entweder schätzt oder ablehnt. Diese Kritik untersucht die Widersprüche, das Primitive hinter der glatten Rede, aber das alles wird an der Sprache selbst untersucht, an den Wörtern und Sätzen. Der langen Rede kurzer Sinn: Das Sprachdenken erschließt in der Sprache das Politische.
Ich gestehe, dass ich den Altphilologen als Zeuge für dieses Problem beschäftige, weil ich glaube, dass nicht zuletzt für Bildung von Demokraten ein traditioneller Bildungsbegriff (der die alten Sprachen mit einschließt) wenigstens nicht ausgeschaltet werden sollte. Derzeit hat die österreichische Regierung einen Wissenschaftsminister, der aus dieser alten Schule kommt, den Altphilologen Töchterle, über den ein Chefredakteur schrieb: „Karlheinz Töchterle war ein absoluter Glücksgriff. Der Wissenschaftsminister spricht wie ein Mensch, nicht wie ein Polit-Computer.
Es ist ein schönes Paradox, dass das Gesetzgebende, dass die Legislatur der Sprache die Bedingung für ihre Freiheit ist – und auch für unsere Freimütigkeit. In seinem Gedicht über den Reim hat Karl Kraus herausgearbeitet, wie der Regeldruck des Reims die Freiheit der poetischen Einbildungskraft organisiert und vorantreibt. Ich habe einmal gehört, dass der Samba so entstanden ist: Unter den schwarzen Sklaven, die man in Brasilien einst von den Schiffen lud, befanden sich auch edle Könige aus Afrika. Die Füße eines jeden Gefangenen waren aneinander gefesselt, und weil sie nicht wollten, dass man ihre Erniedrigung sah, machten sie schnelle Schritte, die den Eindruck ihrer Freiheit erwecken sollten. Ich weiß nicht, ob es jemals so war, aber selbst als Fiktion bleibt es ein gutes Bild für die Dialektik von Fesselung und Befreiung, in der allein Freiheit dem Menschen zugänglich ist.
Ja, zur Bildung des Demokraten gehört der Sinn für das Politische der Sprache. Zur Bildung gehört eine erregbare Sensibilität gegenüber den sprachlichen Zumutungen. Es müssen sich alle Haare aufstellen und es muss ein Zittern den Körper erfassen, wenn im Fernsehen eine Hungersnot in Afrika mit den Worten erklärt wird: „Es ist ein Cocktail aus Verschiedenem, der die Hungersnot verursacht.“ Aber der zitierte deutsche Altphilologe hat in meiner Leseart noch ein anderes Problem zur Sprache gebracht: Wer nämlich unterscheidet bei allen möglichen Kostümierungen und Verstellungen, was unverstellt ist? Das ist doch eine gewichtige Bildungsfrage – und nichts anderes kann Kritik doch heißen: Kritikfähigkeit auszubilden heißt ein Unterscheidungsvermögen auszubilden. Unterscheiden und dann bewerten – im Übrigen gescheiter als umgekehrt, dass man – was ja allzu menschlich ist – reflexartig erst bewertet und dann unterscheidet. Es hört sich an wie aus einem Katechismus der Postmoderne: Erst kennt man sich nicht aus und dann, wenn man sich zurecht gefunden hat, glaubt man nicht sicher gehen zu können, ob es der richtige Weg ist. Ans Wahre kommt man nicht heran.
Hans Blumenberg nannte die Postmoderne schlicht „schlachtreif“, und ich denke, das hat auch mit dem Stil der gepflegten Verunsicherung, mit dieser „entschieden Unentschiedenheit“ zu tun. Lassen Sie es mich bitte vulgär sagen, aber ich glaubte, mich trifft der Schlag, als ich lesen musste, dass man selbst in der katholischen Kirche dieser Spurenverwischung der Urteilskraft und ihrer Schwäche nicht entkommt. „Ich glaube“, sagte Kardinal Schönborn, „der Reformdruck ist generell höher geworden. Und damit verbunden auch Verunsicherung. Nicht nur in der Kirche, auch in der Gesellschaft – etwa in der Finanzfrage, der Pensionsfrage, der Umweltfrage. Lösungen hat niemand in der Tasche. In der Kirche ist es ähnlich. Wir spüren, dass es großer Reformen bedarf. Wenn man aber genauer hinschaut, was eine echte Lösung wäre, sind wir auch hier – wenn wir ehrlich sind – in mancher Hinsicht ratlos.“
Wir sind ehrlich. Ich wette, dass der postmoderne Geisteszustand eine Auswirkung der sogenannten „Post-Demokratie“ ist. Das ist ein Begriff des Politikwissenschaftlers Colin Crouch und es ist nicht unbedingt ein Kampfbegriff; er könnte als deskriptiv, als gegenwartsdiagnostisch durchgehen. Man sieht – ganz ohne Wissenschaft – auf den ersten Blick, dass die real existierende Demokratie nicht ihrem Ideal entspricht – man sieht es zum Beispiel an Berlusconi oder daran, dass etwa (wie Günter Grass es behauptet) im deutschen Bundestag Abgeordnete tagen, die weniger Volksvertreter als Vertreter von Konzernen sind, für die sie Lobbying betreiben. Man sieht es an der etablierten Rufschädigung, an den Verachtungsroutinen, mit der Medien Politikern gegenüberstehen. Umgekehrt erkennt man am Murdoch-Skandal, wie Medien, die kriminell agieren, dies auch tun können, weil sie mit Politikern vernetzt sind. Man erkennt es an einem aggressiven, selbstbewussten Desinteresse vieler Bürger, für die Politik oder überhaupt irgendetwas von einem Gemeinwesen nicht in Frage kommt. Man erkennt es, derzeit in Österreich, an einer Korruption, die moralisch offenkundig ist, wenn sie auch juristisch noch nicht in allen Fällen fixiert werden konnte. Hinter dieser Korruption steht eine für Österreich beispiellose Verachtung demokratischer Institutionen. Postdemokratie heißt am Ende auch, dass das demokratische System als Ganzes ins Kippen geraten kann.
Den Parlamentarismus nannte Karl Kraus einst die Kasernierung der politischen Prostitution. So sprach Karl Kraus, ein Mensch, der von sich wusste, dass er – wie zum Beispiel auch Schopenhauer – eine Elite verkörperte und dem das Herausragen aus dem Rest der Menschheit eine Selbstverständlichkeit war. Was für eine solche Elite am Parlamentarier widerwärtig ist? Ein Parlamentarier muss, um es zu bleiben, um Stimmen werben. Er [S. 9] ist also unsouverän, abhängig von anderen, sprich: Er muss sich – in den Augen vollständig Unabhängiger – prostituieren.
In der Postdemokratie ist das Werbeprinzip professionalisiert, verwissenschaftlicht und kommerzialisiert. Von der Einstellungsforschung bis zu (psychologisch ausgetüftelten) medialen Techniken der Beeinflussung benützt die Politik alles, um für sich zu werben. Werbung scheint ja in diesem Stadium der Gesellschaft den meisten Menschen viel plausibler zu sein als eine elaborierte politische Debatte. Man glaubt, mit Hilfe der Werbung, auf Grund ihrer Plausibilität, den Abgrund, der zwischen den entpolitisierten Massen und den auf Politik spezialisierten (und von der Politik lebenden) Menschen besteht, zu überbrücken. Der Politiker inseriert sich auf Gedeih und Verderb. Das aber hat seinen Preis, nicht nur den, den das jeweilige Medium kassiert: „Werbung“, schreibt Crouch, „ist keine Form des rationalen Dialogs. Sie baut keine Argumentation auf, die sich auf Beweise stützen könnte, sondern bringt ihr Produkt mit speziellen visuellen Vorstellungen in Verbindung. Auf Werbung kann man nicht antworten. Ihr Ziel ist es nicht, jemanden in eine Diskussion zu verwickeln, sondern ihn zum Kauf zu überreden. Die Übernahme dieser Methoden hat den Politikern dabei geholfen, das Problem der Kommunikation mit dem Massenpublikum zu bewältigen; der Demokratie selbst haben sie damit jedoch einen Bärendienst erwiesen.“
Da ist schon wieder ein Bär, jetzt im Dienst, vorhin beim deutschen Altphilologen im Tanz, wenn auch gefesselt. Aber der zitierte deutsche Altphilologe hat, nachdem er die Schwierigkeit, die postmodernen Verstellungen und Kostümierungen aufzuklären, benannt hat, doch eine Antwort gegeben – seine Antwort. Die Postdemokratie irritiert, es scheint, als könnte man sich für nichts mehr entscheiden als für die Unentschiedenheit. Und das verweist auf ein Paradox der Bildung von Demokraten: Man wird Menschen zur Kritik, also auch zur Skepsis bilden, aber ebenso zum Vertrauen aufs eigene Urteil.
Unterscheidungsvermögen und Urteilskraft sind nicht Fähigkeiten, mit denen man sich den (gar nicht so seltenen) Wunsch erfüllt, frei zu schweben – den Wunsch als eine Art höherer „Mann ohne Eigenschaften“ jenseits aller Realisierungen dahin zu wesen. Unterscheidungsvermögen und Urteilskraft dienen dazu, sich begründet festlegen zu können, und dieses Vertrauen aufs eigene Urteil hat – analog zum passiven und aktiven Wahlrecht – auch einen anderen Sinn: Der demokratische Sinn für Kritik ist – leider – erst dann vollständig, wenn ein Sinn fürs Selber-Kritisiertwerden sich ihm zugesellt. Der Möglichkeit nach ist in der Gesellschaft jedes Subjekt auch Objekt. Mein Demokrat muss lernen, auch Objekt der Kritik zu sein.
Kluge Leute, die die Nützlichkeit der Kritik erkannten, haben oft versucht, die Kritik, der man sonst ausgeliefert ist, zu organisieren, zu kanalisieren. Sie wollten nur den Honig, sie wollten der Kritik den Stachel ziehen. Kritik – erlauben Sie mir die Banalität, weil sie so folgenreich für das Zusammenleben ist – Kritik ist schwer auszuhalten. Außerdem kommt bei meiner Utopie noch hinzu, dass man sich das Vertrauen aufs eigene Urteil durch keine Kritik vorschnell erschüttern lassen darf. Das ist schon schwer, und jetzt ist es auch noch ambivalent, denn selbstverständlich darf das Vertrauen aufs eigene Urteil – nicht in den Starrsinn münden. Der Sinn für Kritik umfasst die Selbstkritik, die aufgeklärte Auflösung der Dogmen eben, denen man selbst anhängt. – Ist so viel Utopie zu fassen?
Nichts Unfassbares hier, sondern lieber ein Hinweis, wie denn Kritik zu lehren sei. Da Zweifel und Wissen, sagte Montaigne, gleich wichtig sind, lege man den Schülern die Vielfalt der Meinungen vor, und wenn der Schüler eine Meinung übernimmt, ob von Plato oder Xenophon, ist es nicht mehr deren Meinung, sondern seine. Jetzt fällt mir ein, was ich von Schopenhauer zitieren wollte, nämlich den elitären Unwillen, sich etwas anzulesen: „Nur die eigenen Gedanken“, sagt Schopenhauer, „haben Wahrheit und Leben; denn nur die eigenen Gedanken versteht man ganz. Fremde, gelesene Gedanken, sind geschissene Scheiße.“
Dagegen war Montaigne Demokrat, und die Demokratie ist voll von angeeigneter Bildung, also von einem Universum des Sekundären, das so übermächtig ist, dass man dagegen – auch wieder im Sinne der Demokratie – an die alte Elite erinnern will. Das gehört zu meiner Utopie: Demokratie in der Bildung ist nicht die Nivellierung aller auf ein Niveau, sondern sie ist im Interesse aller auch ein, produktiver Umgang mit den herausragenden Werken, also nicht zuletzt mit Menschen, die fürs Demokratiespiel nicht zu haben waren. Konkret: Gegenüber Nietzsche, Ernst Jünger oder Carl Schmitt bleibt man mit politischer Korrektheit im Hintertreffen. Falls man da mitkommen will, muss man sich schon mehr anstrengen.
Ich habe die Freimütigkeit der Rede als demokratisches Fundament auch deshalb vorgetragen, weil es besonders in Österreich an ihr mangelt. Politisch korrekt forderte ich Angstfreiheit und nicht Angstmache im Unterricht. Karl Kraus, der den liberalen Geist und erst recht den Geist des Liberalismus hasste, wäre allerdings nicht mit mir gegen Professor Pospisil, wie ihn doch ein jeder Gymnasiast hatte, auf die Barrikaden gestiegen. Lust aus Leiden war Kraus nicht fremd, jedenfalls weniger fremd als das Versprechen, durch Entschärfung alles zum Guten zu wenden. So sagt er: „Die Humanität hat den Alpdruck der Furcht vor dem ,Drankommen‘ beseitigt, aber das gefahrlose Schülerleben wird unerträglicher sein als das gefährliche. Zwischen ,vorzüglich‘ und ganz ungenügend lag ein Spielraum für romantische Erlebnisse. Ich möchte den Schweiß um die Trophäen der Kindheit nicht von meiner Erinnerung wischen. Mit dem Stachel ist auch der Sporn dahin. Der Gymnasiast lebt ehrgeizlos wie ein Weltweiser und tritt unvorbereitet in die Streberei des Lebens, die sein Charakter ehedem schadlos antizipiert hatte, wie der geimpfte Körper die Blattern. Er hatte in der Schule die Gefahren des Lebens bis zum Selbstmord verkostet.“
Erziehung als Impfung – man lernt in der Schule leben, indem man durch sie sogar den Selbstmord, das Daseinsextrem schlechthin antizipiert. Das gibt jedem Gott Kupfer recht (Gott Kupfer hieß der sadistische Lehrer in Friedrich Torbergs Buch „Der Schüler Gerber“), aber es ist etwas Wahres dran, dass eine übertriebene Schonung von Wesen, die ins Leben hinaus müssen, sie im Stich lässt. Ich würde es nicht wagen, Kraus zu zitieren, bloß um zu bedeuten, dass ich anders als er denke. Auf die Romantik, die der Qual entstammt, kann man verzichten. Sie ist eine Ideologie, die nur bei entsprechender psychischer Disposition greift. Aber die Kunst muss der Pädagoge schon beherrschen, [S. 10] einerseits zu schützen, anderseits aber die Schutzbefohlenen Gefahren auszusetzen, damit sie nicht erstaunt und wehrlos sind, wenn wirklich welche kommen. Jedenfalls zeigt sich, dass es Weltbilder sind, zum Beispiel konservative gegen liberale, mit denen am Ende Bildungspolitik gemacht wird.
Bei Karl Kraus kommt nicht bloß die Lebensfremdheit, sondern auch die Lebensfeindlichkeit als Pathologie der Bildung vor: „Bildung ist eine Krücke, mit der der Lahme den Gesunden schlägt, um zu zeigen, dass er auch bei Kräften sei.“ Das steht nolens volens in der Tradition von Nietzsches Kritik am Ressentiment. Kraus ist ambivalent – er hegt durchaus einen Begriff von wahrer Bildung, als dessen hervorragender Exponent zumindest für ihn sein eigenes Werk gilt – Kriterium ist dabei, kein Wissen aus zweiter Hand. Siehe Schopenhauer.
Aber ich denke, niemand kann im Ernst glauben, alles selber zu wissen, alles von selber oder aus sich selbst zu wissen. Der Wissenserwerb ist auf die fremde Quelle angewiesen. Gemeint können nur Aneignungsformen sein, die das Wissen sozusagen, siehe Montaigne, in eine eigene Leistung ummünzen. Würde man auf den hohlen Kopf vertrauen (also auf einen, der auch keine eigenen Aneignungsformen hätte), stünde man vor einem ungeheuren Wissensberg, den man sich jetzt in den Kopf stopfen müsste. Aussichtslos, aber es gibt vollgestopfte Köpfe, die nicht mehr hohl sind, sondern im Gegenteil überfüllt. Dagegen waren die Hohlköpfe noch beweglicher.
Der Ausweg aus dem Dilemma ist eine Bildung, die hinter der Wissensbildung steht. Eine Bildung, mit der man einen Kopf hat, durch den man das unendliche Wissen auf Grund der nicht zuletzt in der Lebenswelt erworbenen Subjektivität reduziert und verarbeitet: sich aneignet. Dabei spielt das Interesse eine Rolle – es ist einerseits vom Wissbaren geweckt, aber anderseits kommt es vom Lebenswandel, auch von dessen Begrenzungen. Es ist schon ein allzu menschliches Spiel, glücklich die Unbegrenztheit des Wissens mit den eigenen Grenzen leidenschaftlich zu vereinen und zu wissen, dass die Diskrepanz, die Wissenslücke zum größten Teil offenbleibt: dass man also, wie der Philosoph: weiß, dass man nicht weiß.
An anderer Stelle in seinem Kampf gegen die Liberalen, die Bildung propagieren, spricht Kraus vom „Präservativ Bildung“ – also wieder das Moment der Unfruchtbarkeit des Gebildeten. Bildung zeugt nichts, sie ist zeugungsunfähig, und da kommt bei Kraus ein Argument, das auf die barbarischen Anteile in der Kultur setzt. Die Kultur, so Kraus, würde vom „Hausknecht“ vorangebracht, also nicht vom gebildeten, sondern vom rohen Menschen. Das ist einerseits wahr, denn wenn Bildung nicht überhaupt Fülle für die Leere ist, dann ist sie doch auf einen Kanon eingeschworen. Sie schöpft ihre Kenntnisse aus bestehendem Wissen, kontrolliert sich selbst anhand von Gegebenem – damit bringt man die Kultur nicht voran. Man schafft so höchstens, wie die Politikerphrase heißt, „die Rahmenbedingungen“ für das Voranbringen. Zum Fortschritt gehört die Abweichung, von mir aus, auch eine bestimmte Brutalität, mit den eingebürgerten Regeln zu brechen.
Anderseits hat man gerade von Karl Kraus lernen können, dass dem Hausknecht ebenso wenig wie den Vertretern des Establishments, auch des Bildungsestablishments zu trauen ist. Aber auf das Barbarische in der Kultur für ihr Vorankommen zu setzen, ist in jedem Fall ein Spiel mit dem Feuer. Es ist ein Spiel, das ausgespielt hat. Dass auch „die Bildung“ ausgespielt hat, hat zum Beispiel Adorno, der anderseits die immer noch bestehenden Bildungsprivilegien bekämpft hat, in der gewohnten dialektischen Widersprüchlichkeit behauptet. Am Ende meines Vortrags bin ich dort angelangt, wo das Thema brenzlig wird. Ich bin ja noch jung und habe noch lange Zeit, mich damit zu beschäftigen, aber vorerst kann ich sagen, wenn Bildungsskepsis auch immer geboten sein mag, es gibt in der Gesellschaft Formen der Rohheit, der Gemeinheit und der Niedertracht, die ganz ohne Bildungsverbrämung auskommen. Einige davon sind sogar populär. Aber auch den noch unpopulären gilt der Kampf von Demokraten.
Es gibt eine signifikante Spannung im Bildungsbegriff: Bildung umfasst einerseits das „Kunststück“ individueller Selbstkonstitution und anderseits die mindestens ebenso artistische Fähigkeit, es mit dem von der Gesellschaft „aufgeherrschtem Zwang“ aufzunehmen. Da einem eh nichts anderes übrig bleibt, schöpfe ich Hoffnung und mache mir über die Zukunft der Bildung keine Sorgen mehr. Ich bin, obwohl ich darauf nicht mehr zu sprechen kommen kann, nicht damit einverstanden, den Bildungsbegriff mit der Trennung von Bildung und Ausbildung ideologisch zu überfrachten. Die Ausbildung räumt den Menschen, über ihre Berufe sowohl einiges an Selbstkonstitution ein als auch einiges an der demokratischen Partizipation, an der Teilhabe an der Gesellschaft. Ich bin auch nicht damit einverstanden, den Bildungsbegriff mit der Zwei-Kulturen-Theorie, also mit der Trennung von Natur- und Geisteswissenschaften ideologisch zu überfrachten. Eine Trennung zwischen naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Bildung sei unsinnig, sagt Hubert Markl, ein Naturwissenschaftler, denn es ginge in jedem Fall um die „Fähigkeit zu klarem, kritischem Denken und begründetem Argumentieren.“
Markl verspottet den Bildungsdünkel, zu dem ich neige, weil er Spaß macht. Nichts ist schöner als der (von Markl angewidert zitierte) „sorgfältig eingeübte Rückgriff auf einen kanonischen Vorrat von Geistesgütern, wie er sich in zierlichen Zitaten, metaphorischen Anspielungen auf klassische Werke und in der Fähigkeit äußert, aus dem Stand darauf hinweisen zu können, dass Platon, Montesquieu, Hume oder Kant ein Argument bereits folgendermaßen – und zwar treffender – begründet hätten.“
Leider bin ich nicht gebildet genug, um dieses Glasperlenspiel der Bildung perfekt zu spielen. Daher kommt mir Markls demokratischer Bildungsbegriff gerade recht. Danach wäre gebildet, „wer tugendhaft und lebenstüchtig ist“, und der Zusatz übertrifft diese Formel noch an Klugheit: „Lebenstüchtigkeit allein genügt nicht, dazu erweisen sich viel zu viele Lumpen als nur allzu tüchtig; und Tugend ohne Tüchtigkeit ist es, die jene Lumpen gerade so erfolgreich sein lässt.“
(Wortwahl, Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung entsprechen dem Original. Die im Original durch Kursivsatz und Großbuchstaben hervorgehobenen Wörter werden ebenso in Kursive und Großbuchstaben wiedergegeben. Worte in Fettdruck werden ebenfalls kursiv wiedergegeben. Ausrücke in runden Klammern stehen auch im Original in runden Klammern. In eckigen Klammern steht die Zahl der jeweiligen Seite des Originaltextes. Offensichtliche Fehler wurden berichtigt.)