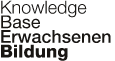Der Dorfpfarrer als Volksbildner
Full display of title
| Author/Authoress: | Teufelsbauer, Leopold |
|---|---|
| Title: | Der Dorfpfarrer als Volksbildner |
| Year: | 1923 |
| Source: | Österreichisches Volksbildungsamt (Hrsg.): Führer für Volksbildner, H. 10, Wien 1923. |
[S. 3 ] Einführung
„Nimm Hack’ und Spaten, grabe selber,
die Bauernarbeit macht dich groß.“
(Goethe, Faust II)
Es gibt wohl kaum ein ergreifenderes Bild der ganzen heiligen Geschichte, als unseren Herrn, weinend über das Geschick Jerusalems und seines Volkes. Der schönste Tag seines mühevollen Lebens ist gekommen. Nach so vieler anstrengender Arbeit und erbitterter Gegnerschaft scheint sich ihm das Volk zuzuwenden. Tausende umjauchzen und umdrängen ihn, da er in feierlichem Zuge der Hauptstadt naht. Palmen und Ölzweige werden im Jubel geschwungen, Kleider auf seinen Weg gebreitet. Immer wieder erhebt sich der Freudenruf: Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Die hellen Stimmen der Kinder, sie singen darein und grüßen ihren großen Freund. Begeisterung und Freude hat alles ergriffen. Und er, dem all der Jubel gilt – er weint, vergißt bittere Tränen, weil ihm das furchtbare Geschick seiner Heimat und seines Volkes nahe geht. O wahrhaft göttliches Herz, du konntest nicht jubeln und froh sein, weil du deiner Heimat und deines Volkes nicht vergessen konntest.
Liegt das Bild unserer Heimat nicht auch so vor uns. Vergebens, so scheint es, sind all die heldenhaften Anstrengungen der Söhne unseres Volkes gewesen, vergebens das Heldenblut, das geflossen, vergebens die heroischen Opfer, die manche Familie gebracht. Entehrt und zu Boden getreten, gebunden und gefesselt, so ist unsere liebe Heimat aus den Friedensverhandlungen hervorgegangen. Eine harte, gefühlslose Feindesfaust beugt uns nieder. Doch was alle Siege uns vielleicht nicht beschert, das hat sie uns dargeboten – sie hat uns Volk und Heimat wieder finden gelehrt. Ja, [S. 4 ] zu den ewigen Wurzeln unserer Kraft, zu denen wollen wir wieder niedersteigen, um unser Volk von neuem zu erheben, um es wieder gesunden zu lassen. Haben wir auch viel verloren, den Glauben an die Zukunft kann uns niemand rauben und mit dem Dichter klingts in unseren Herzen hoffnungsfroh:
„Wir sind gebrochen – aber nicht im Mark! Da drinnen pulst noch treu und stark Die alte Kraft, der alte Mut Und spricht: es wird noch alles, alles gut! Es kommt dereinst der große Tag, Da hellt der Himmel sich mit einem Schlag, Da sproßt aus unserer Heldenbrüder Blut Nach kummervoller Jahre Flucht Vieltausendfach der Todesopfer Frucht. Wir wissen alle: Aufrecht gilts zu stehn, Denn Deutschland, Deutschland kann nicht untergehn. Wir beißen nieder allen Schmerz der Wunde Und werfen trotzig selbst in dieser Stunde Den alten Spruch dem Feinde ins Gesicht: Den deutschen Geist erschlugt ihr nicht! An deutschem Wesen Wird doch noch einmal alle Welt genesen.“
Ja, unser Volk muß wieder emporkommen. Eine hohe, aber auch schwere Aufgabe, doch deutsches Blut hat nie vor hartem Kampf zurückgescheut. Führten vor dem nur auserlesene Kreise unser Volk, dann muß heute jeder mithelfen, vor allem auch jener Stand, aus dem noch immer die Erneuerung des Volkes hervorgegangen ist: der deutsche Bauernstand. „Vom Bauernstand, von unten aus, soll sich das neue Leben in Adels Schloß und Bürgers Haus, ein frischer Quell erheben,“ hat einst schon Schenkendorf gesungen. „Stadtluft macht frei“, hieß es in der Zeit der salischen Könige, heute muß es heißen: „Landluft macht gesund!“
In tätiger, opferbereiter Arbeit hat sich der Bauernstand gerade während des Krieges wieder die allgemeine [S. 5 ] Beachtung errungen. Heute betrachten ihn viele nicht mehr wie einst als den notwendigen Aufputz der Gebirgslandschaften, als einen Stand, von dem man nur wußte, daß er Getreide, Milch und Butter erzeuge, daneben aber roh und ungebildet sei und keine Manschetten bei der Arbeit trage. Dank der bitteren Lebenserfahrungen des einzelnen, der bahnbrechenden Arbeiten eines l’Houet, Weigert, Stapel, Steinberger und anderer steht er heute wieder angesehen da. Man hat den Bauernstand als Schaffer und Spender des täglichen Brotes schätzen gelernt. Man ist tiefer in sein Verständnis eingedrungen. Das Bauerntum mit seiner gesunden, natürlichen Lebensweise ist die natürliche Kraft- und Lebensquelle für die Erneuerung der städtischen Bevölkerung. Jahr für Jahr ziehen Tausende von gesunden Landbewohnern – oft gerade die geistig regsamsten – in ihrer besten Schaffensfreudigkeit in die Stadt, um hier das absterbende Blut der Großstadt zu verjüngen und erneuern. Die Stille des Landes, die unverbrauchte Kultur des Bauernvolkes, sein gesunder Wahrheits- und Wirklichkeitssinn, der in seinen geistig strebenden Söhnen lebt, sind der geistige Jungbrunnen, der die von der Siedehitze der Stadt oft einseitig vorwärtsgetriebene Kultur wieder zum Besten des ganzen Volkes regelt. „Die Stadtkultur ist so in ihrem besten Kern, wie in ihren wirtschaftlichen, physiologischen, biologischen und sozialen Voraussetzungen abhängig von der Landkultur, zehrt von ihr,“ sagt mit Recht Keller in seiner Schrift: Heimatmission und Dorfkultur, Seite 7. Nicht die Stadt allein ist das Segenbringende, das muß endlich zu aller Erkenntnis kommen, auch das Land hat seine große Bedeutung.
Hineingestellt in das Bauerntum durch sein Wirken und oft auch durch seine Abstammung innig mit ihm verwachsen, sein treuer Freund in Not und Leid, sein teilnehmender Gefährte an seinen kleinen Lebensfreuden, sein Führer und Helfer in allen Lebenslagen, sein Weggenosse von der Wiege bis zum Grabe ist „der Priester“. Hat er das Herz seiner Leute gewonnen, dann wurde ein Band geknüpft, das beide [S. 6 ] fest zusammenhält, das keine Macht der Erde mehr lösen kann. So mancher, der das Wirken des Priesters nicht kennt, die Seele des Bauernvolkes nicht versteht, spricht dann vielleicht von einer Herrschsucht der Priester, von der dummen Gläubigkeit des Bauern. Würde er wissen, aus wieviel Herzensfäden dieses Band gewoben ist, wie viele stumme Händedrücke da oft eine Freundschaft besiegelt haben, um die jahrelang geworben wurde, wieviel Herzenskummer Bauer und Priester so vertraut gemacht, er würde anders sprechen. Innig hängt das Landvolk darum auch an seinen Priestern. Es hat sie nicht vergessen, mögen sie oft auch Jahrzehnte schon von ihrem Posten geschieden oder gestorben sein, ihr Name und ihr Andenken lebt weiter. Darum hat das Landvolk auch den Priester in sein geistiges Gut aufgenommen. Vom Dorfpfarrer weiß das Märchen zu erzählen, zahlreiche Schwänke vom Pfaffen vom Kahlenberg bis zu einem knorrigen Original der Jetztzeit und einem Hockewanzel leben im Volke weiter. Werden Lieder angestimmt, dann bekommt der Pfarrer in einem Vierzeiler auch als dazugehörig seinen Teil, werden die Stände des Dorfes verspottet, dann gehts auch über den Pfarrer, der vormittag kann Kinder taufen, nachmittag das Geld versaufen. Fragt man den Sänger: Was braucht man in an Bauandorf, dann ist die erste Antwort: „An Pforra, der schen singt.“
Ist der Pfarrer so innig mit seiner Gemeinde verwachsen, dann wird und muß ihm auch das Wohl seiner Gemeinde am Herzen liegen, dann muß er mit klarem Auge erkennen, daß die heutige Zeit wohl mehr von ihm verlangt, als ein bloßer Kirchenbeamter zu sein. „Der Aufgabenkreis des Dorfpfarrers, der mehr als Messe lesen und predigen will, wächst mit der Kenntnis der Verhältnisse. Und ich glaube je mehr er wirklich Pfarrer ist, umso größer werden seine sozialen Pflichten.“1
Unsere heutige Zeit ist nicht spurlos auf dem Lande vorübergegangen. Materialismus, Genußsucht und Hartherzigkeit, [S. 7 ] oft in rohester Gestalt, sind – meist als traurige Spende der Großstadt – auch aufs Dorf gekommen. Die Seele des Bauernvolkes ist krank geworden und das Volk ahnt es nicht. Betört vom Flitter und Schimmer, dem Gegaukel und Getue der Großstadt, hat es seine alte gediegene Kultur dahin gegeben und städtische Kultur und noch mehr Unkultur angenommen. Bitter rächt sich dies auf dem Lande. Die Bauernschaft droht uns entwurzelt, heimatlos und damit seelisch vernichtet zu werden. Soll nun dieser Stand, der einer der Träger der ganzen Volksgemeinschaft, der wie gesagt der geistige und körperliche Jungbrunnen für die anderen Stände ist, soll dieser rettungslos zugrunde gehen? Hieße das nicht unserem Volke die Möglichkeit eines Aufstieges für alle Zeiten rauben? Nein, ein Herz, das in wahrer christlicher Liebe für sein Volk schlägt, das in Begeisterung an seiner deutschen Heimat hängt und noch eines höheren Gedankens, eines Glaubens an das Gute, an eine bessere Zukunft fähig ist, kann es nicht zugeben. Es wäre ganz verfehlt zu glauben, die Zeit heile alle diese Schäden. Da heißt es in langer, ernster Arbeit, unser liebes Landvolk wieder emporheben, ihm die reichen Quellen seines Volkstums erschließen, die Landkultur zu einem gleichberechtigten Faktor neben der Stadtkultur erheben, das Landvolk zu einem harmonischen Ausgleich zwischen den vernünftigen Forderungen der Jetztzeit und seiner berechtigten Eigenart führen, kurz ein umfangreiches Wirken entfalten, das wir heute als ländliche Volksbildungsarbeit bezeichnen. Wir wollen keineswegs den Riß, der heute schon zwischen Stadt und Land besteht, noch erweitern, aber beide sollen sich als gleichberechtigt schätzen und verstehen lernen – dann wird wieder ein Friede möglich sein.
Als einen schlichten Begleiter für diese Bildungsarbeit will ich die vorliegende Schrift anbieten. Sie will keine gelehrte Abhandlung sein. Einem einfachen Gebirgspfarrer fehlten dazu die nötigen Behelfe und die die Eignung. Hat ja von uns Landpfarrern schon Scheffel das launige [S. 8 ] Wort gebraucht, daß es mit des Wissens schwerem Rüstzeug spärlich war bei ihm bestellt. Wohl aber will ich einen Baustein zu dem Werke beitragen, an dem schon viele Vertreter unseres Standes wie ein Heinen, Christ, Frank, Weigert, Keller, Weiler, Steinberger, Pramberger u. a. arbeiten. Der Verfasser ist sich mancher Schwächen wohl bewußt, ist ja seine Schrift meist aus dem praktischen Leben herausgegangen und da muß die Zeit an manches auch noch die verbessernde Hand anlegen, doch er tröstet sich mit den Worten des Dreizehnlindensängers: „Gern gereicht, ist unverächtlich auch des kleinen Mannes Gabe.“ Wenn in seiner Schrift nur vom Bauerntum die Rede ist, so soll dies keine Geringschätzung der anderen Stände sein, sondern geschieht nur, weil für einen Dorfpfarrer nur dieses in Betracht kommt. Der Ausdruck Dorfpfarrer ist keineswegs streng kirchenrechtlich zu fassen, sondern nur im volkstümlichen Sinne, wo das Landvolk jeden Geistlichen „Pfarrer“ nennt.
Mögen sich, das war der Herzenswunsch des Verfassers bei seiner ganzen Arbeit, mögen sich bald viele Gefährten zur Arbeit finden, ja möchten viele begeisterte Landseelsorger aufstehen, die sich zusammenschließen, um mit vereinten Kräften das große Werk der ländlichen Volksbildungsarbeit zu fördern. Wieder ist das Volk und Land in Not und gleich dem Novizen in Hanrieders „Bauankriag“ wollen auch wir das Gelöbnis ablegen: „I halts mit’n Volk und Land.“ Leutpriester nannte das Mittelalter den Seelsorger und Leutpriester, Priester für das Volk, wollen auch wir bleiben nach des Apostels Wort: „Allen alles werden.“ Gott gesegn’s!
[S. 9 ] Die Person des Pfarrers
„Ich glaube, die Möglichkeit, Gutes zu leisten, hat niemand auf dem Dorfe so wie der Pfarrer,“ schreibt Laßmann in seinem gediegenen Werke „Unsere Landgemeinden und das Gemeindeideal“. Ja, gewiß hat er die Möglichkeit; wie oft aber bleibt diese Möglichkeit ungenutzte Gelegenheit, wird nie zur Wirklichkeit. Worin mag der Grund liegen? Steinberger, der steirische Bauernbildner, hat mit kennender Seele den Finger auf die Wunde gelegt, wenn er das Wort von der „Bauernfremdheit“ der heutigen gelehrten Stände sprach. Unsere heutige Erziehung ist stark vom wirklichen Leben abgewandt, noch immer zehren wir an dem Vermächtnis der humanistischen Gelehrtenschule, die in vollständiger Abkehr vom deutschen Wesen sogar die deutschen Namen latinisierte. Griechische und römische soziale Probleme und Kulturfragen werden des langen und breiten erörtert, da muß der arme Student die Klassen der Bevölkerung des alten Athen und Sparta kennen, hört von einer Verfassung eines Solon und Lykurg, muß die Verfassungskämpfe des alten Rom mit all ihren leges genau wissen, von der Gliederung des mittelalterlichen Deutschlands, von deutscher Volksseele, von der Entwicklung seines eigenen Volkes, von dem Werden des Bauernstandes hört er blutwenig. Germanisches Siedlungswesen, Herrschaft- und Untertänigkeitsverhältnis, Robot und Zehent, Hand- und Spanfronen, Besthaupt und Zinshahn, Hausrecht und Flurzwang, Bannteiding und Weistum kennt er meist nicht einmal dem Namen nach. Wie armselig und hilflos steht er dann dem Bauernvolke gegenüber, das in seinem ganzen Sinnen und Denken noch in der Überlieferung wurzelt. Wie wenig [S. 10 ] Anknüpfungspunkte findet auch das Volk zum „studierten Herrn“. Studiert ist nicht probiert, sagt das Volk und zeigt damit, wie es jeden Studierten für lebensfremd hält. Und hat ein Student auch das Glück, aus einem Bauernhause abzustammen, wie hat man nicht den Bauernstand als etwas Minderwertiges vor seinen Augen hingestellt, oft waren es die eigenen Eltern selber, meist aber hat ihm die Stadt diese Grillen in den Kopf gesteckt, bis er wirklich überzeugt war, unendlich erhaben über den dummen Bauern zu sein. Und dann die Universitätsjahre. Wo wäre da Gelegenheit, die Bauernseele mit ihrem Denken und Fühlen kennen zu lernen. Die hohe Wissenschaft schwebt in den höchsten Regionen und oft verliert sie dabei den festen Boden, auf dem sie stehen und wirken soll. Die Klage in der „Dorfkirche“, 1. Jahrgang, von den protestantischen Pastoren: „Es wurde ausgesprochen, daß religionsgeschichtlich und volkskundlich unsere Heidenmissionäre besser vorgebildet an ihre Aufgabe in der Ferne herantreten als unsere jungen Pastoren meistens an ihre Arbeit in der heimatlichen Landgemeinde“,2 gilt oft auch von den katholischen Priestern. Kann es dann wundernehmen, wenn so mancher Seelsorger auf dem Lande, der in der Stadt geboren, nie auf das Land gekommen, trotz besten Willens keine Verbindung mit dem Landvolke findet, wenn sich beide als unverstanden fremd gegenüber stehen, wenn er dann wieder zur Stadt flüchtet, die Verständnis, geistige Anregung, Fortbildung und vieles andere bietet, was das Land nicht bieten kann.
Wie viel also hat unsere heutige Schulbildung gefehlt, wenn sie den jungen Menschen mit allen möglichen Kenntnissen vollpfropft und ihm doch nicht die Augen öffnet für das Wichtigste, für sein Leben und Wirken unter seinen Mitmenschen!
Dazu kommt die Überschätzung, die in der öffentlichen Meinung der Anstellung und Wirksamkeit in der Stadt entgegengebracht wird. Theoretisch sind wohl alle [S. 11 ] gleich, praktisch aber und dies oft auch pekuniär ausgedrückt, geht die Stadtanstellung immer voran. Das Wirken auf dem Lande, das immer stiller und bescheidener sein wird als das in der Stadt mit ihren lärmenden Problemen, wird leicht übersehen oder als geringfügig, wenig Mühe und Arbeit erfordernd hingestellt. Manchen Seelsorger zieht es darum hinaus aus der Enge und Armseligkeit des Dorfes, das ihm keine geistige Anregung bieten kann, das der vollen Entfaltung seiner Persönlichkeit und seiner Kräfte nur hindernd im Wege steht. Er findet keine Zeit, auf dem Dorfe bodenständig und eingesessen zu werden. Wie beklagenswert aber für das Dorf selbst der häufige Wechsel seiner Seelsorger ist, wird von allen Einsichtigen schon längst erkannt. Pfarrer Weiler sagt treffend: „Der Land- und Dorflehrer und ebenso der Dorfgeistliche ist leider vielerorts nur Dorfgast, nicht voller Dorfbürger, nicht bodenständig und heimfest und darum selten ganz heimfroh,“3 und Viktor Geramb fügt in seiner Schrift „Von Volkstum und Heimat“ die Mahnung ein: „Höret auf, der Heimat ihre besten Kräfte zu entziehen und sie nur als Verbannungs- und Strafposten für politisch Minderbegabte oder Abgetane anzusehen.“
Und doch leben und wirken so viele Priester unter dem Bauernvolke, haben da Befriedigung, Freude gefunden und würden ihre Stelle um keinen Preis mit einem Platze anderswo tauschen wollen! Gewiß! Es ist und bleibt ein Ehrenzeugnis für uns Priester, daß wir uns so leicht in die Gesinnungsart des Bauernstandes wieder hineingefunden und daß so viele Priester mit ihrer bäuerlichen Gemeinde eins geworden sind. Das erkennen auch viele Freunde des Dorfes an. Scheffel hat in seinem „Trompeter von Säkkingen“ dem Pfarrherrn auf dem Lande eine Kranz gewunden und der große Volkskenner Geramb schreibt in seinem bereits genannten Werke: „Unserer Geistlichkeit darf gerechterweise allerdings am wenigsten von allen Gebildeten der Vorwurf der Volksfremdheit gemacht werden; geht sie doch zum weitaus [S. 12 ] größten Teil aus dem Bauernstande hervor. Ich kenne Gebirgs- und Dorfpfarrer, die wie eine feste Säule und Stütze stehen inmitten des sozialen Lebens einer ganzen Bauernpfarre, das sich in allen seinen Äußerungen hilfesuchend an sie klammert und um sie bewegt. Das sind die wahren Priester und Seelenhirten, die sehr häufig von der vorüberziehenden Außenwelt als verbauerte Sonderlinge bestaunt, belächelt und – bedauert werden. Allein sie schwinden mehr und mehr dahin. Und wie traurig steht’s dann um eine solche Gemeinde, wenn das alte Vaterherz aufhört zu schlagen und irgendein junger volksfremder Theologe seine Nachfolge als ‚Strafposten‘ erhält! In wieviel innerste Heimlichkeiten der Volksseele muß er als Seelsorger Einblick nehmen, die er nie und nimmermehr verstehen kann, weil die Kluft zwischen ihm und dem Volke zu weit und zu tief geworden ist und weil seine Mittel- und Hochschulbildung alles getan hat, um diese Kluft zu vergrößern und nichts, um sie zu überbrücken. Für einen solchen Hirten ist dann freilich seine Stelle wirklich ein Strafposten, nur daß leider auch alle seine Schafe die Strafe miterleiden müssen.“4
Viele Priester sind ja aus dem Bauernstande hervorgegangen, haben in den Ferien in der väterlichen Wirtschaft mitgeholfen und so wurden sie vor der Gefahr bewahrt, aus der bäuerlichen Ideenwelt herausgerissen zu werden. Für sie ist ein Anknüpfen ein leichtes. Auf beiden Seiten finden sich so viele Berührungspunkte, daß ein inniges geistiges Band zwischen Pfarrer und Gemeinde bald zu binden ist. Andere wieder sind mit dem besten Willen auf einen Landposten gekommen, eigene Erfahrung, das lehrende Beispiel der andern, hat sie bald den besten Weg zum Volke finden lassen.
Braucht schon der Seelsorger in der Stadt innigen Verkehr mit seiner Gemeinde, Verständnis für ihre Nöten und Bedürfnisse, dann ist dieses innige Verständnis für den Landseelsorger geradezu Lebensnotwendigkeit. Wenn das Bauernvolk sich von seinem Seelsorger nicht verstanden fühlt, [S. 13 ] wenn ihre Ansichten in den wichtigsten Punkten oft entgegengesetzt sind, dann wird es ihm bald fremd gegenüberstehen und ihm aus dem Wege gehen. „Mit dem läßt sich nichts machen,“ ist das Endurteil. Der Bauer hat ja kein psychologisches Verständnis dafür, daß andere Naturen anders sein können als er. Wann wäre ihm im Verkehr mit seinesgleichen dieses je gekommen. Was kann also er zur Annäherung tun? Annäherung und Entgegenkommen muß von Seite des Seelsorgers erfolgen. „Der ankommt, muß zuerst grüßen,“ sagt das Landvolk. Jeder Landseelsorger braucht daher Volkskenntnis und Volksliebe oder vielleicht besser zuerst Liebe zum Volke, dann wird er auch zur Volkskenntnis kommen.
Er braucht dazu keine großartigen Studien zu betreiben, nur ein offnes Auge und ein mitfühlendes Herz, dann lernt er seine Leute von selbst kennen. Ein Spaziergang führt ihn hinaus in Gottes schöne Natur. Ein paar Leute arbeiten in der Nähe. Der Landpfarrer geht nicht mit einem kalten Hutrücken vorbei. Er macht eine Bemerkung über das Wetter, über die Arbeit, erkundigt sich vielleicht nach einem Familienmitglied, das nicht anwesend ist, gibt dem Gespräche eine ernstere oder auch eine scherzhafte Wendung und er wird immer freudigen Anklang finden. Irgend eine Angelegenheit führt ein Pfarrkind in die Kanzlei. Das Landvolk liebt solche offizielle Gänge nicht, wie froh ist dann jeder, wenn er frei und ungezwungen sich benehmen und so auch sprechen kann, wenn der Pfarrer an seinen ganzen Lebensverhältnissen innigen Anteil nimmt. Wie freut sich der Bauer, wenn sich ihm der Pfarrer bei einem Gange als Gesellschafter anschließt, wenn er sieht, daß sich mit ihm „ganz gut auskommen lässt;“ forscht der Pfarrer dann noch nach dem Gange der Wirtschaft, ja hat er vielleicht gar noch gemerkt, daß der Huberbauer seit einer Woche ein neues Pferd hat und lobt nun das prächtige Tier, dann hat er sich des Bauern Herz erobert. Auch die jungen Leute, die oftmals recht rauh und borstig erscheinen, sind lange nicht [S. 14 ] so, wenn der Seelsorger es versteht, mit ihnen umzugehen, und danken dann dem Seelsorger mit einer großen Anhänglichkeit. Ein gutes Wort richtet bei ihnen oft mehr aus als hundert Strafreden.
Hat der Seelsorger Gelegenheit, dann suche er seine Leute manchmal auch in ihrem Hause auf. Er lernt so ihre häuslichen Verhältnisse kennen, die ihm oft vieles erklären. Nur darf er sich nicht entsetzen, wenn er in manchem Hause oft nicht die nötige Ordnung findet. Konnten die Leute vor lauter Arbeit nicht die nötige Zeit finden, dann beruhige man sie: „In einer Werkstätte, wo viel gearbeitet wird, müssen auch Späne sein.“ Ist Unordnung die Schuld, dann kann ein ernsteres Wort am Platze sein. Jedenfalls sind die Sonntagnachmittage am besten zu einem solchen Gang. Doch ländlich, sittlich! Hier kann man bei einem gemütlichen Plausch viel tun, um seinen Leuten näherzukommen. Ist ein Familienmitglied ernster krank, dann wird sich jeder Kranke freuen, wenn ihn der Pfarrer öfters heimsucht, ihn tröstet und ihm die lange Zeit vertreiben hilft. Was kann man nicht bei solchen Krankenbesuchen lernen!
„Herr Doktor, das ist schön von Euch, daß Ihr uns heute nicht verschmäht und unter dieses Volksgedräng’ als ein so hochgelahrter geht,“ sagt der Bauer in Goethes Faust, so freut sich auch das Bauernvolk, wenn der Priester an seinen Freuden und Leiden Anteil nimmt. Wenn sich das Volk ungezwungen gehen läßt, dann lernt der Seelsorger seine Seele am besten kennen. Doch nur nichts Gezwungenes und Förmliches dabei! Nichts stört die Liebe und das Vertrauen mehr als ein eisiges Formeltum. Der Pfarrer muß zuerst reden, darf nicht auf die Anrede warten, er muß einen Spaß verstehen können, darf nicht jedes Wort, das man zu ihm spricht, auf die Wagschale der Etikette legen, muß mit dem Großbauer wie mit dem Halterknecht und Ziegelschläger gleich gemütvoll umgehen können, dann hat er die Liebe seiner Gemeinde gewonnen. Dann gilt sein Wort etwas in der Gemeinde, besonders wenn er auch bei [S. 15 ] allen Unternehmungen, die die Förderung des materiellen Wohlstandes bezwecken, wie Raiffeisenkassen, Genossenschaften, Kasinos und ähnlichen nach Kräften mitarbeitet.
Die Anwesenheit des Pfarrers wird auch immer auf die anderen mäßigend einwirken, nur muß der Pfarrer in den anderen, vor allem den älteren Gemeindemitgliedern einen festen Rückhalt finden. Das fühlte schon Goethe. In Dichtung und Wahrheit, 12. Buch, schreibt er: „Fest- und Feiertage auf dem Lande, Kirchweihen und Jahrmärkte, dabei unter der Dorflinde erst die ernste Versammlung der Ältesten, verdrängt von der heftigern Tanzlust der Jüngern, und wohl gar die Teilnahme gebildeter Stände. Wie schicklich erschienen diese Vergnügungen, gemäßigt durch einen braven Landgeistlichen, der auch dasjenige, was allenfalls übergriff, was zu Händeln und Zwist Anlaß geben konnte, gleich zu schlichten und abzutun verstand.“ Nur so, durch innigen Verkehr mit dem Volke, wird der Priester sein Volk und die Leute ihren Priester kennen, achten und lieben lernen.
Die Person des Bauern
„Du frommer, freier Bauernstand,
Du liebster mir von allen,
Dein Erbteil ist im deutschen Land
Gar lieblich dir gefallen.“
(Max v. Schenkendorf)
„A Spitzbua muaß’s sein, der an Bauan varocht, wann koan Baua nit war, wurd koan Ocka nit gmocht.“ War einst dieser Vierzeiler von Berechtigung, dann haben heute die gewaltigen Leistungen und Opfer des Bauernstandes in Kriegs- und Nachkriegszeit sowie die fortschreitende Volkskunde eine gerechtere Würdigung des Bauernstandes herbeigeführt. Während die anderen Stände schon überall in Auflösung begriffen sind oder sich aufgelöst haben, bietet der Bauernstand noch immer ein einheitliches Bild. Seine Lebens- und Arbeitsbedingungen ändern sich ja nur sehr wenig. Leider ist der alte kernige Bauer, der ein echter Vertreter seines [S. 16 ] Standes war, immer mehr im Schwinden. Ein verstädterter, entwurzelter Bauer oder „Wirtschaftsbesitzer“, wie er sich selbst nennt, droht sein Nachfolger zu werden.
Wie man von einer Volksseele spricht, so kann man auch von einer Bauernseele sprechen. Jedem, dem es vergönnt ist, unter dem Volke zu wirken, der wird folgendes Bild von dem Wesen des Bauerntums erhalten:
1. Das Bauerntum ist naturhaft, innig mit der Natur verknüpft. Der Bauer lebt in innigem Zusammenhang mit der Natur und in Abhängigkeit von ihr. Die freie Natur ist seine Arbeitsstätte. Tag für Tag beobachtet er ihr Wirken und Schaffen, das ihm bald günstig, bald feindlich ist. Ist seine Arbeit getan, dann muß er ruhig alles werden und wachsen lassen. Darum hat er warten gelernt. In seinem ganzen Wesen liegt etwas Ruhiges, Bedächtiges, Abgeklärtes, Zuwartendes, das sich in allen seinen Reden und Handlungen, ja schon im Gange zeigt. Er ist kein Freund im Vorwärtsstürmen. Viertelstundenlang kann er reden oder noch lieber schweigen, bevor er mit seiner Absicht herausrückt. Der Bauer hängt darum auch am Gewordenen, das kennt er. Vor dem Neuen hat er Scheu. „Neue Schuhe muß man erst treten und oft passen sie gar nicht,“ sagt er. Vielen gilt der Bauer deshalb als geistesstumpf, doch das ist er keineswegs. Wenn es Not ist, weiß der Bauer seinen Vorteil gar wohl zu wahren und mancher „aufgeklärte Städter,“ der gedachte, den „dummen Bauern“ anzuführen, sah sich unvermutet recht kräftig hineingelegt. Der Bauer muß manchen Fehlschlag in seiner Wirtschaft erleben, es kommt oft anders, als er vorher berechnet. Darum hält er nicht viel auf Plan machen und vieles Reden. Er lässt lieber alles an sich herankommen, als vorzeitig dagegen Vorsorge zu treffen. Der Bauer ist still und in sich hineinversunken, hält mit seiner Meinung zurück, bewahrt eine große Gemütsruhe in Freud wie im Leid. Gemütsroh nennt wieder eine falsche Beobachtung den Bauern. Hätte nur ein jeder dieser Spötter soviel Gemüt wie mancher Bauer. Unvergeßlich bleiben mir das meine eigenen Kindheits- [S. 17 ] tage, wo ich den Erzählungen meiner lieben Mutter lauschte, die, obwohl nur eine schlichte Bauersfrau, doch ein reiches Gemütsleben besaß. Jedes Tierlein, jede Pflanze, ja der Stein wurde unter ihren Worten beseelt, und als ich einst einen jungen Feldhasen von den Taglöhnern zum Geschenk erhielt, da wußte sie mir so eindringlich den Schmerz der armen Hansenmutter zu schildern, die nun ihr Kind vergebens suche und nach ihm weine, daß ich mit Tränen im Auge noch am Abend aufs Feld ging und dem Häslein wieder die Freiheit gab. Willst du das Gemüt des Bauernvolkes kennen lernen, dann lausche nur den innigen Klängen eines einfachen Volksliedes, höre einer Mutter zu, wenn sie ihren Kindern von den Wundern der Natur erzählt und alles tiefgläubig mit dem Himmel verflicht. Wie viele Pflanzen stehen im Volksmunde mit der Mutter Gottes oder dem Leiden des Herrn in Verbindung. Die eine heißt Marienblümchen, die andere Muttergottesschuh, die Unserer lieben Frau ihr Bettstroh, die andere ist entstanden, wo die Blutstropfen des Herrn auf die Erde fielen. Wer kennt nicht die Erzählung von der Espe oder die von der Weide, die trauert, weil die Schergen ihre Zweige genommen, um den Herrn zu geißeln. Oder die schöne Erzählung von der Weizenähre. In früheren Zeiten, so erzählt das Volk, war die Ähre nicht wie jetzt bloß an der Spitze des Halmes, sondern reichte bis zur Erde. Doch die Menschen trieben argen Unfug mit der edlen Gottesgabe und Gott der Herr wollte sie strafen, indem er die Halme ohne Ähren wachsen lassen wollte. Das war es nun unsere liebe Frau (auch so eine gemütstiefe Bezeichnung!), wie das Volk so lieb erzählt, die die Ähre in die Hand nahm und den lieben Gott bat, er möchte doch soviel verschonen, als sie mit der Hand bedecken könne. Der Herr willfahrte ihrer Bitte und seitdem trägt jedes Weizenkorn innen ein Bild der heiligsten Dreifaltigkeit. Wie viele solcher Züge ließen sich noch anführen!
Welche Tiefe des Gemütes bei den bäuerlichen Sitten, beim Abschiednehmen der Braut von dem Elternhause, beim [S. 18 ] Einführen der jungen Frau in das neue Haus, beim schönen Pfüat-Gott-Nehmen vom Toten! Freilich, der Bauer ist still und scheu in seinen Gemütsäußerungen, vor Fremden wird er sie nicht zeigen. Einst stand ich vor einem offenen Grabe. Ein junges Bauernweib war gestorben, zwei kleine Kinder und der Mann trauerten um sie. Doch kein lauter Schmerzensausbruch. Wäre ich nicht bei dem Tode dieser Frau zugegen gewesen und hätte den Mann gesehen, wie er sich im Übermaß des Schmerzes über sein Weib warf, ich hätte keine Ahnung gehabt, was der Mann an Trauer im Herzen trug. Hat der Bauer auch ein reiches Gemütsleben, so läßt er es im Alltag wenig mitsprechen. Seine Arbeit ist zu schwer, als daß er sich einen Gefühlsüberschwung leisten könnte. Da leitet alles der kalte Verstand, das Gefühl muß zurücktreten, daher erscheint er uns hart in vielen Dingen wie bei Heiraten u. a.
Seine anstrengende Arbeit lehrt den Bauer auch das Erworbene schätzen, darum wird er oft selbstsüchtig. Die Arbeit anderer erscheint ihm gering im Vergleich zu seiner. Von Kindern und Dienstboten verlangt er volle Leistungen. Für ihn hat der Mensch nur Wert, soviel Arbeit er für ihn leistet. Daher auch das Unverständnis, das der Bauer oft den staatlichen Einrichtungen entgegenbringt. Er beurteilt nur den Augenblickswert, den sie für ihn haben. In Überschätzung des Erworbenen kann der Bauer auch hart und stolz werden gegen den Ärmeren.
Der ständige Aufenthalt in der Natur führt den Bauer zu scharfer Naturbeobachtung. Er denkt in allem nur konkret. Für ihn gibt es keinen Gattungsnamen, kein Getreide, nur: Weizen, Hafer, Gerste oder Korn, kein Pferd, sondern einen Hengst, eine Stute, einen Wallach, kein Rind, sondern Stier, Kuh oder Ochs. Nicht Rußland und Deutschland führen miteinander Krieg, sondern der Russe mit dem Deutschen. Erzählt er Geschehnisse, dann sind sie subjektiv gefärbt, immer wird der Anteil, den er selbst hatte oder eines der Angehörigen, gebührend hervorgehoben, ja ganz [S. 19 ] in den Vordergrund gestellt und oft zum Mittelpunkt der Ereignisse selber gemacht. Ereignisse, von denen darum der Bauer nicht selbst berührt wird, noch auch die ihn umgebende kleine Welt, finden auch wenig Interesse. „Was geht mich Nürnberg an, wenn ich kein Haus drinnen hab’.“ Darum ist es auch schwer, den Bauer für allgemeine Fragen zu gewinnen. Immer kommt er mit der Querfrage, wenn auch nur im Stillen, was hab’ ich davon.
2. Der Bauer ist unpersönlich, er ist kein Eigenmensch, sondern ein Massenmensch. Soweit geht seine Unpersönlichkeit, daß er, wie im Gebirge, sogar das Persönlichste, seinen Eigennamen verliert und den Namen des Hofes annimmt. Den Johann Steiner kennt niemand, den Birkhofer aber jeder. Er will darum auch nicht aus der Masse der anderen herausragen. Originale unter den Bauern liebt man nicht, man läßt diese „extrigen Leit“ abseits liegen. Der gewöhnliche Bauer ist für den Durchschnitt. Er will beileibe nicht schlechter sein als die anderen, aber auch nicht besser. Was bei einer Sammlung der erste gibt, nach dem richten sich alle. Dem Bauer fehlt der drängende Impuls nach vorwärts, er läßt sich lieber drängen und schieben, statt selbst voran zu gehen.
3. Der Bauer hat noch gesundes Seelenleben. Er kennt nicht die zerrütteten Nerven der Großstadt. Ein nervöser Mensch heißt ihm ein „Zwiderling“. Aufrechten Sinnes schaut er dem Unglücke ins Auge. Stark beginnt er nach jedem Schicksalsschlage sein Lebensglück aufs Neue zu zimmern. Sind die Verhältnisse unabänderlich, dann fügt er sich ins Unvermeidliche. Zwei Ehegatten, die sich anfänglich nicht zusammenfinden können, müssen sich nach seiner Meinung eben „zusammenbeißen“ und sie finden sich gewöhnlich auch. Stark ist der Bauer auch in seiner schwersten Lebensstunde, beim herannahenden Tode. Da gibt es kein Verheimlichen: „Ich weiß jo, daß i sterben muaß, holts ma in Pforra und donn kemmts zsom, daß ma Urdning mochn.“ Kein feiges Ausweichen, wie es in der Stadt schon gang und [S. 20 ] gäbe wird. Ruhig erwartet er sein Ende, oft noch in der letzten Stunde mehr um die andern als um sich bekümmert. So kannte ich einen Bauern, der noch in den letzten Zügen seinen Hinterbliebenen auftrug, welches Faß Wein sie bei der Totenzehrung nehmen sollten, damit ja kein minderwertiger verwendet würde. Einst kam ich auch auf einen Bauernhof zu einem sterbenden Bauern. Seine Stunden, ja Minuten waren gezählt. Er konnte nur mit Mühe mehr sprechen. Er winkte seinem Weibe zu sich und flüsterte ihr zu, sie möchte doch dem Geistlichen, der so weit heraufgegangen, ein Stück Speck bringen, im Feldkasten hänge er.
Wie der Bauer innen denkt, so zeigt er es auch nach außen, er umschreibt seine Gefühle nicht, wenn ihn nicht eine moderne Zeit heucheln gelehrt hat. Aufrichtig aber wird er immer im Zorne, da sucht er seinen Gegner auf der wundesten Stelle zu treffen und weiß ihn auch zu treffen. Jahrzehntelang vergessene Begebenheiten werden da wieder ausgegraben und mit schonungsloser Härte hingeworfen, darum die erbitterten Feindschaften, die daraus entstehen. Ist der Bauer gezwungen abzulehnen und will nicht verletzen, dann tut er dies oft in der schlauesten Weise. Unangenehme Fragen überhört er gewöhnlich. Wird ihm das Gespräch peinlich, dann beginnt er in größter Naivität ein anderes, muß er einen Antrag abweisen, dann kann aus der ganzen Gesprächsführung der Wissende bald erkennen, woran er ist.
Seine Empfindungen spricht er deutlich aus, oft zu deutlich nach unserer Meinung. Der Bauernbursch weiß in seinen Liedeln nichts als seine Liebeslust hinauszuschreien. Auf erotische Dinge lenkt der Bauer gerne sein Gespräch und ist einem derben Witze gar nicht abhold. Geschlechtliche Verhältnisse werden ohne viel Rücksicht auf die jungen Leute behandelt, höchstens daß man noch auf die zuhörenden Kinder achtet, doch auch diese schauen schon frühzeitig dem Geschlechtsleben der Tiere zu. Umständlich beschreibt der Bauer seine Krankheit und erörtert auch ausführlich die natürlichsten Vorgänge dabei. Er findet an allem wenig [S. 21 ] Anstößiges, daher fällt es ihm auch schwer, sich in das Seelenleben Anderer zu versetzen. Fremde Empfindungen kann er nicht abschätzen.
4. Der Bauer ist religiös – seinem ganzen Sinne nach. Seine Religion ist nicht, wie so viele glauben, nur das stumpfe Beugen vor einer höheren und unerklärlichen Macht. Es ist wahrer, frommer Glaube und meist auch ein Leben nach dem Glauben. Wie wenig aber wird die Religion des Bauern verstanden! Jeder naseweise Stadtlehrbub meint schon mit weiß was für einer Verachtung auf den Bauern herabschauen zu müssen, wenn er diesen offen seine Religion bekennen sieht. Für den Bauern ist die Religion Lebensinhalt und Lebensweihe, und soweit ich mein Volk kenne, unterschriebe ich die Worte Steinbergers: „Das Landvolk ist in seiner Masse frommgläubig und ihm ist die Religion, und zwar nicht eine bloße Innenreligion ohne äußere Betätigung, sondern eben seine Religion, wie sie ist, mit allen nach außen gerichteten Erscheinungen und Formen, abgesehen von der metaphysischen Bedeutung, ein Bedürfnis, nicht minder oder richtiger noch mehr als dem Nichtgläubigen sein Gang in die Natur, der Besuch des Theaters u. dgl., ist ihm Sitte und Brauch, ist sein Heiligtum, an das er nicht rühren läßt. Wer ihm daran rührt, erscheint ihm als Gegner.“5
So nüchtern und real der Bauer in seinem ganzen Gehaben ist, so hat er doch in seinem Herzen einen Winkel, den er mit übersinnlichen Dingen, mit Riesen und Geistern, Waldfräulein und Irrlichtern, Drachen und umherwandernden Teufeln angefüllt hat. Die ganze Natur ist ihm belebt und ich kannte einen alten Taglöhner in meinem Vaterhause, der jedes Stück Arbeitsgerät unter seinen Händen zu beseelen wußte. Den meisten Bauern ist dieser innerliche Schatz wohl selber fremd, er beginnt erst Leben anzunehmen, wenn er durch eine schauerliche Geschichte geweckt wird. Arndt sagt von seiner Jugendzeit im bäuerlichen Vaterhause: „In meiner Kindheit, da wandelten noch Gott und die Engel um die [S. 22 ] Häuser der Menschen und die Wiegen der Kinder, da gingen noch Gespenster rund, Märchen aus alter Zeit tönten süß zu dem Wiegenlied der Nacht und alte Lieder wurden gesungen, im Frühling und Herbst klangen sie frisch aus Feldern und Büschen.“
Dieses allgemeine Bild des Bauerntums erhält nun nach den verschiedenen Gegenden, in denen das Bauervolk wohnt, auch verschiedene Züge. Österreich ist kein altes deutsches Stammland, sondern erst im Laufe der Zeiten durch deutsche Ansiedler besiedelt worden, nur das Innviertel muß hier als altbayrischer Stammsitz ausgenommen werden. Den Großteil aller Einwanderer stellte der benachbarte bayrische Stamm. Seine Eigenart hat sich dem österreichischen Volke auch am meisten aufgeprägt, das zeigt schon die Sprache. Von dem bayrischen Stamm mag auch die große Freude an Sang und Tanz herkommen, die Lust zu Volksspielen und Aufzügen, die Lust zu schauen, die den Österreicher auszeichnet. Daneben wanderten noch vorzüglich in Niederösterreich und in einigen Teilen Oberösterreichs Franken ein. Von ihnen mag wohl die österreichische Leichtblütigkeit und Lebensfreude als Erbteil sich herleiten. Diese Bevölkerungsmischung ist noch heute zu erkennen. Darum muß man, wenn man die bäuerliche Gesinnungsart einer Gegend genau kennen lernen will, auch auf ihr geschichtliches Werden achten. Der fränkische Weinländler Niederösterreichs hat eine ganz andere Lebensart und Lebensauffassung als der Alpenbauer Innerösterreichs. Der Mühlviertler Oberösterreichs ist verschieden vom Innviertler, der Waldviertler von dem Bewohner der Haager Gegend.
Großen Einfluß übt natürlich auch die Landschaft aus, in der ein Bauernvolk wohnt. Die abgeschlossenen Alpen mit ihrem rauhen Klima, in dem das Brot nur in harter und schwerer Arbeit geschaffen werden kann, die abgeschlossene Lage, der ernste schweigende Wald, werden die Bauern ganz anders beeinflussen als das offene Marchfeld oder das vielbesuchte Weingebiet, das bereits stark in den Bannkreis der Großstadt einbezogen ist und viele Wechselbeziehungen mit der Großstadt unterhält.
[S. 23 ] Unser Bauernvolk zeigt sich also, soweit es nicht von der Zivilisation verdorben oder angekränkelt ist, als ein naturhaftes, starkes, naives, tiefgläubisches Volk, dem Abstammung und Gegend noch eine besondere Note aufdrückt, „eine jünger gebliebene seelische Entwicklungsstufe unseres Volkes,“ wie Houet sagt. Leider hat unsere moderne Zeit in dieses Bild so manchen Schattenstrich hineingezeichnet. Der echte, wahre Bauer als Vertreter des Bauernstandes und Bauernsinnes ist auch in heutiger Zeit weniger und im Bannkreis der Städte sehr selten geworden.
Die Gründe dafür waren gar mannigfach. Unsere Kultur vor dem Kriege war in ihrem ganzen Wesen keine Volkskultur sondern Stadtkultur. Hier pulsierte das ganze geistige Leben, hier wurde gearbeitet und geschaffen, vorwärts gestrebt und getrachtet. Das stille Leben des Dorfes verschwand dagegen. Mitleidsvoll sah der Städter auf den Bauern herab. Ja, selbst von Freunden des Bauernstandes wurde schon die Frage aufgeworfen, ob es sich lohne, den Bauern zu erhalten, und nicht vielleicht besser wäre, ihn der ausländischen Konkurrenz zu opfern. „Es wird sich einmal die folgenschwere Frage erheben, ob diese kostspielige Erhaltung unseres Bauernstandes nicht die Lebensfähigkeit des Volksganzen ernstlich gefährdet.“6 War es zu wundern, wenn der Bauer in seiner ihm aufgedrungenen Aschenbrödelstellung, die ihm nicht einmal Sicherung des Lebens verhieß, sich unbehaglich fühlte, wenn vor allem die geistig Begabten mächtig vorwärts drängten. Hätte man diese geistige Strömung auf dem Lande in die richtigen Bahnen zu leiten verstanden, das Landvolk hätte geistig gewaltig gehoben werden können. So aber verlor es seine besten geistigen Kräfte in die Stadt. Bauernsöhne, die in der Stadt arbeiteten, kamen mit Stadtideen aufs Land hinaus, jeder Rekrut, der zur Stadt zog, sah das Wunder, das sich vor seinen Augen entrollte, mit staunender Seele an und kehrte als begeisterter Apostel der Stadtkultur ins Dorf zurück, die studierten Söhne des Bauernstandes, [S. 24 ] Lehrer, Geistliche, Ärzte, waren in ihrem Studium ihrem väterlichen Stande fremd geworden, nun fürchten sie sich vor der geistigen Öde des Bauerndorfes und zogen auch lieber zur Stadt. Die geistige Nahrung des Bauern, Zeitung und Bücher, waren in der Stadt verfaßt und verherrlichten nur das Leben in der Stadt. Die Bildungsstätte des Bauern, die Volksschule, arbeitete ganz nach städtischem Muster. Was Wunder, wenn dem einfachen Landmann die Stadt mit ihrer Kultur als das höchste erschien, wenn man in Bauernhäusern so oft das Wort hörte: „Mein Kind darf nicht so dumm sein, ein Bauer zu werden, oder darf mir keinen Bauern heiraten.“ Und was geschah gegen diese Ausbeutung des flachen Landes, die Pfarrer Weigert in seinem Buche (Das Dorf entlang, S. 108) zahlenmäßig nachweist? Gar nichts! Wo waren die berufenen Führer, die dem Bauernvolke die Schäden der Großstadtkultur oder besser Unkultur aufgedeckt, die ihm seinen Stand lieb und wert gemacht hätten!
Und was, so muß man weiter fragen, gab die Stadt dem Land zurück? Keller gibt darauf die bittere Antwort: „Für die lebenspendenden Säfte, die vom Dorf her ihr fortgesetzt einströmen, gießt sie über das Dorf ihr Gift und ihre Fäulnis aus.“7 So drangen von allen Seiten die Keime der Zersetzung der ländlichen Kultur aufs Land. Die Fieberhitze des Krieges mit seinen unnatürlichen Erwerbsverhältnissen, die Hamsterfahrten, bei denen das Landvolk systematisch zur Gesetzesübertretung, zur Habgier und Lieblosigkeit erzogen, ja förmlich gezwungen wurde, brachten die Keime zum Reifen und ihre Frucht war entsetzlich. So manche Bauern sind dem Materialismus verfallen. Habgier und Raffgier hat sich ihrer bemächtigt, Herzenshärte jedes Gefühl abgestumpft, städtische Vergnügungssucht findet sich auch im Bauernhause. Das Christentum ist vielfach zum bloß äußerlichen Schein geworden, kein Glaube mehr, sondern bloßer Brauch. Es hätte keinen Sinn, vor diesen Erscheinungen, die sich besonders in der Nähe der Städte und an den Ver- [S. 25 ] kehrslinien zeigen, die Augen zu schließen. Ja, unsere Bauernschaft ist durch den Krieg vielleicht materiell besser gestellt, aber geistig gewiß ärmer geworden. Viele Bauern erkennen bereits die Schäden, sind sich aber über die Mittel zur Hilfe nicht klar.
Unser Landvolk emporzuheben, es wieder geistig reicher zu machen, es sich auf sich selber besinnen zu lassen, auf die starken Kräfte, die aus seiner bäuerlichen Eigenart, aus Heimat und deutschen Volksbewußtsein, aus den Lehren des Christentums hervorfließen, das ist Aufgabe der ländlichen Volksbildung. Sie will das Landvolk anleiten, in rechter Ausbildung seiner geistigen und körperlichen Kräfte selbständig und zur eigenen Zufriedenheit, wurzelnd in seiner Heimat, in starkem Volks- und Standesbewußtsein, nach seiner religiösen und sittlichen Überzeugung alle Aufgaben zu lösen, die ihm das Leben für seine eigene Person oder für andere stellt.
Was will diese trockene Erklärung besagen? Vor allem das eine, daß Volksbildungsarbeit Volkserziehungsarbeit ist, kein bloßes Vortraghalten ohne Einflußnahme auf Willen und Gemüt. Wer aber seine Leute erziehen will, der muß sie kennen, daher ist eine genaue Kenntnis von Heimat und Volk die Voraussetzung für jede gedeihliche Arbeit. Ziel der Arbeit soll sein, jeden anzuleiten, daß er, kurz gesagt, wieder ein rechter Bauer werde.
Der Pfarrer als Volksbildner
„Gut und fromm ist jedes Wissen,
So es frommt den Menschenkindern,
So es Seelenqual zu schweigen,
Leibesnot vermag zu lindern.“
(Weber, Dreizehnlinden.)
Wie kann der Pfarrer als Volksbildner tätig sein? Eine allgemeine Antwort läßt sich darauf nicht geben. Jeden führt Eignung und Freude seinen eigenen Weg, da jeder seine Leute auch am besten kennen wird. Darum liegt es [S. 26 ] mir auch ganz ferne, Richtlinien für die Arbeit aufzustellen, dazu halte ich mich nicht berufen, nur Gedanken dazu will ich aussprechen, wie ein jeder Dorfpfarrer ein Kenner und Schützer der Heimat und ein Erzieher seiner Leute werden kann.
Einst hatte ich mit einem Bauern einen längeren gemeinsamen Gang zu machen. Über verschiedene Dinge ging die Rede und endlich meinte der Mann sinnend, wie es denn nur kommen mag, daß bei uns die Häuser und Felderlage ganz anders sind als draußen am Landboden (hier das Flachland um Wien gemeint). Ich konnte ihm Antwort geben und so unterhielten wir uns über Siedlungsgeschichte, Dorfgeschichte, Volkskunde auf das beste, wobei alle zwei Nutzen hatten. Ist ein Pfarrer in der Lage, über die Geschichte der Heimat, des Dorfes fesselnd zu sprechen, dann wird er immer Zuhörer haben. Mancher schöne Volksbildungsabend läßt sich damit erreichen. Wie komme ich nun zur Kenntnis der Heimat? Vor allem halte ich einmal Umschau in den geruckten Werken. Eine Beschreibung der einzelnen Orte in Landestopographien oder Schematismen existiert in den meisten Bundesländern. (In Niederösterreich die Topographie des Vereines für Landeskunde, acht Bände, reichend bis zum Buchstaben P (Persenbeug), ein minderwertiger Ersatz für das fehlende ist: Schweickhardt, Darstellung des Erzherzogtums Österreich unter der Enns.) Sie gibt eine kurze Übersicht über die Ortsgeschichte, die allerdings bei älteren Werken sehr vorsichtig aufzunehmen ist. Eine Chronik der benachbarten größeren Orte vervollständigt dann das Bild, doch es wird noch immer sehr dürftig, leer und inhaltslos sein. Ein paar trockene Zahlen, bloße Namen, aber kein geschichtliches Leben. Eine dankenswerte Arbeit wäre nun die Abfassung einer Ortsgeschichte. In den langen stillen Winterabenden wird das Pfarrarchiv und wo ein Gemeindearchiv vorhanden, auch dieses durchgearbeitet. Reiche Beute liefern auch die alten Pfarrmatriken, die fast gar nicht ausgewertet werden. Zettel füllen sich mit Bemerkungen. Da [S. 27] steht bei einer Trauung als Zeuge Joh. Haider iudex – also ein Gemeinderichter, da findet sich versteckt eine Nachricht über eine Feuersbrunst, eine Bemerkung in den Gemeindeakten erzählt von einer Strafe, die über die Gemeinde verhängt wurde, weil ein Insasse gefährlich mißhandelt wurde. Die Ortssage berichtet, daß man einst bei einer großen Feuersbrunst den Besitzer des Hauses, in dem sie entstand, ins Feuer werfen wollte, weil man glaubte, er habe den Brand gelegt. Ein näheres Zusehen zeigt, daß die die drei Nachrichten zusammengehören. In den Kirchenrechnungen findet sich bald darauf die Nachricht von der Anschaffung neuer Glocken. Das Bild des Brandes vervollständigt sich immer mehr. Da wieder steht eine Nachricht über Pestverstorbene, draußen auf dem Anger steht ein Pestmarterl, die Ortssage weiß viel davon zu erzählen. Die verstreuten Züge ergänzen sich immer mehr. Manches alte Mütterchen oder mancher alte Vater beginnt zu erzählen, wenn man sich mit ihm über die alten Zeiten unterhält und in geschickter Weise das Gespräch darauf lenkt. Ein trockenes Ausfragen wird nie zum Ziele führen. Aus dem Gehörten ist dann das Wahre auszuscheiden, manches muß erst durch beständiges Vergleichen mit anderen Aussagen und Nachrichten richtig gestellt werden. Aber eines geben uns die Aussagen der alten Ortsbewohner immer: ein lebensvolles Bild der vergangenen Zeit mit all den kleinen Zügen und Bemerkungen, die es gerade dadurch so getreu und für die Ortsbewohner so interessant machen. Ich kann für unsere Gegend die Beobachtungen Eckerts (Probleme und Aufgaben des ländlichen Pfarramtes, S. 57) keineswegs bestätigen, der schreibt, daß die Erinnerung seiner Dorfbewohner selten über den Vater zurückging. Ich habe die Dorferinnerung bis zu den großen Franzosenkriegen zurückverfolgen können, bei besonderen Ereignissen noch viel weiter, und sie hat sich immer ziemlich getreu erwiesen.
Zu der Durchforstung der Ortsarchive möge dann die Durcharbeitung der Archive der Patronats- und der Ortsherrschaft, des Diözesan- und Landesarchivs und des Staatsarchivs [S. 28] treten. Überall wird sich etwas finden lassen, oft mehr als man ahnt. Eine reiche Fundgrube sind auch die bäuerlichen Dachböden. Blieben ja in früheren Zeiten die Gemeindeakten einfach beim jeweiligen Richter zurück und wurden dann auf den Dachboden geschafft; auch die für die Kulturgeschichte so wertvollen Hausübergaben und Vorschreibungen finden sich dort. Leider muß man vielfach die Erfahrung machen, daß man „das alte Zeug“ als wertlos einfach verbrannte. Über die Rechtsanschauungen unserer Vorfahren belehren die Weistümer (herausgegeben von der Akademie der Wissenschaften), über Kulturgeschichte alte Gerichtsbücher, Zehentregister, Grundbücher und die Protokolle der Ortsherrschaften. Viel zu erzählen wissen auch die stummen Zeugen einstiger Zeiten wie vorgeschichtliche Funde, Burgruinen, kunstgeschichtliche Denkmäler u. a.
Aus allen diesen Beiträgen, ergänzt und bereichert durch die Nachrichten der Urkundenbücher, geleitet von dem Gange der Landesgeschichte, wird sich dann ein lebenswahres Bild der Entwicklung des Dorfes geben. Nun erhalten erst die schweigenden Reste vergangener Zeiten, wie die nahe Ritterburg, der massive Kirchturm, das Rathaus mit dem Erker, die Pestsäule, Leben und erzählen von verklungenem Leid und Weh, vom Streben und Schaffen in einstigen Tagen.
Schenken wir im Rahmen der Ortsgeschichte auch der Kulturgeschichte und Volkskunde einen breiten Raum. Wie verschieden war nicht vor sechzig, siebzig Jahren die Bewirtschaftung gegen heute. Wie waren die Preise? Das Erträgnis der Felder? Sind manche Zweige der Landwirtschaft abgekommen? Wie standen und stehen heute die einzelnen Schichten der Bevölkerung zueinander? Die Heimbeschäftigung, der Hausfleiß einst und jetzt! Das Werden der Wohlfahrtseinrichtungen! Das Leben der Dorfbewohner im Alltag, im Jahre, von der Wiege bis zum Grabe, Sagen und Lieder! Vieles, was uns heute selbstverständlich oder kleinlich erscheint, hat bei geänderten Verhältnissen den Wert der Geschichtsquelle.
[S. 29] Doch die mühsame Arbeit darf nicht im Archiv verstauben – Arbeit, die nicht andern frommt, sagt der Dichter, das ist Arbeit ohne Segen –, das Volk soll von der Geschichte seiner Heimat hören. In zwangloser Folge läßt sich manches im Lokalblatt veröffentlichen, vielleicht könnte man auch einen kurzen Auszug der Ortsgeschichte auf einigen Blättern abdrucken und diesen so in jedes Haus hineinbringen. In neuester Zeit gewinnen auch die sogenannten Heimatkalender immer mehr an Verbreitung. Der Gedanke ist sehr gut. Der Kalender ist ja der wahre Hausfreund im Bauernhause. Oft und oft wird er zur Hand genommen, nach Jahren noch hervorgesucht und durchgelesen. Könnte er nicht statt öder Politisiererei oder mancher Geschichte, die nicht einmal die Druckerschwärze wert ist, gediegene Kunde von der eigenen Heimat bringen? Wo dieser Gedanke verwirklicht wurde, hat er noch überall Freunde gefunden. Feiern wir doch die Gedenktage der Heimat, wann die erst erkundliche Erwähnung des Dorfes sich findet, Erbauung oder Weihe der Kirche, Erinnerung an ein großes Brand- oder Unwetterunglück. Vielfach leben diese Ereignisse im Gedächtnisse des Volkes noch weiter, oft findet auch an diesen Tagen ein Gedächtnisgottesdienst der Gemeinde, die sogenannten Gemeindeämter, statt, aber die Erinnerung will immer mehr schwinden. Leben und Inhalt erhalten die Nachrichten aus alter Zeit aber erst durch einen schönen Heimatabend. Ich möchte diesen so veranstalten. Beileibe kein trockener Vortrag und auch keine annalenhafte Aufzählung der Ereignisse! Ein schöner Vortrag, anknüpfend und immer wieder zurückführend an Bekanntes, umrahmt von Gedichten und Liedern, das wird dem Volke am besten gefallen. So: „Wie unsere Vorväter nach Kirchau kamen“.
Einleitung: Ein Heimatlied, In der Heimat ist es schön,
Gedicht: Der Wechselgau von Kernstock.
[S. 30] Vortrag: Die Besiedlung, Siedlungsformen, Erklärung der Gehöftenamen und der sich daraus ableitenden Eigennamen, dazwischen Dialektgedichte Fraungrubers.
Schluß: Volkslied, Das Pittnertal, oder Kein schöner Land …
Oder: Was die heimische Burg erzählt.
Wie entstand unsere Burg. Das Leben auf den Burgen, hineinverwoben der Weckruf des Wächters. Ein Tagelied (vielleicht aus den Meistersingern). Kreuzzüge. Ein Kreuzlied Walters von der Vogelweide. Schwäbische Kunde, von Uhland, oder Die schönste Stadt, von O. Kernstock.
Ein andermal könnte man die Geschichte der Pfarrkirche schildern oder Freud und Leid in alter Zeit (Bauernleben im Mittelalter, Schweden- und Türkenkriege, Pestzeit, Barockzeitalter). Immer aber soll der Vortrag hineingestellt werden ins Volksleben. Der Bauer ist, wie bereits erwähnt, nüchtern und real. Er liebt das Besondere mehr als das Allgemeine. Daher muß seine Heimat, bekannte Punkte der Umgebung eine Rolle spielen, der eigene Urgroßvater oder irgendein Verwandter muß auftreten und sollte er auch bloß den Namen hergeben, die Bewohner des Dorfes müssen handeln oder leidend erscheinen. So hat der Bauer Anknüpfungspunkte und jedesmal wird er gewiß mit Stolz seinen Nachkommen erzählen, was bei der und jener Begebenheit auch der Vorfahr Rühmliches getan hat. Damit ist das Ziel, Anknüpfen an die Vergangenheit, Schätzung und Achtung vor allem historisch Gewordenen, Anteilnahme an der Heimat, auch erreicht.
Noch mehr steht jedem wohl sein eigenes Haus und die eigene Familie. Wie sehr der geschichtliche Sinn in vielen Bauern lebt, das zeigt eine Wanderung durch die Bauernhäuser in unserer Gegend. Beinahe kein Haus, das nicht eine Jahreszahl trüge. Auf dem großen Tragbalken in der [S. 31] Stube findet sich immer der Name des Erbauers und die Jahreszahl eingeschnitten. Die Namen einstiger Besitzer erhalten sich oft als Hausnamen über die dritte, vierte Geschlechterfolge. Wie leicht können wir da an Vorhandenes anknüpfen. Wenn es möglich ist, verfertigen wir für jede ältere Familie Ahnenlisten, in denen der Stamm auch in der weiblichen Linie zurückverfolgt werden kann, wenn der Hof einst durch Heirat auf ein anderes Geschlecht überging. Bekleidete einer der Vorfahren ein Gemeindeamt, war er Ortsrichter, Kirchenvater oder anderes, dann wird es beigefügt. Hat der Hof durch Feuersbrunst oder Wetternot einen Schaden erlitten, so erfolgt die Anführung. Für diese Ahnenlisten könnte ein begeisterter Maler eine schöne Umrahmung mit ländlichen Motiven entwerfen, oben vielleicht ein freies Feld, in das ein Lichtbild des betreffenden Hauses eingeklebt wird, und wir haben dem Bauernhaus einen Schatz gegeben, auf den der echte Bauer so stolz sein wird wie der Graf auf seine Ahnengalerie. Ein Stück Ahnenstolz und Heimatliebe wird in seine Brust einziehen, so oft er die Tafel einem Fremden weist. In manchen Häusern war es Sitte, eine kurze Chronik zu führen, auch mein Großonkel hatte eine solche. Gewöhnlich aber schrieb man die Ereignisse in die Kalender und legte diese zusammen. Ließe sich diese schöne Sitte nicht wieder beleben, die wichtigeren Vorkommnisse in Haus und Familie aufzuzeichnen!
Die Heimat ist aber nicht bloß etwas geschichtlich Gewordenes, sie ist auch ein kleiner Fleck auf unserer lieben Mutter Erde. Darum interessiert uns die Erdkunde, die Naturbeschreibung der Heimat auch. Ein solcher Vortrag, hineingestellt ins Berufsleben der Bauern, wird diesen immer fesseln.
Der Schwarzwaldmaler Thoma hat uns ein schönes Bild gezeichnet. Oben auf ragender Bergeshöh steht ein gepanzerter Ritter, bereit als „Wächter im Tal“ den Frieden des lieben Heimatortes, der ruhig zu seinen Füßen ausgebreitet liegt, gegen jeden Angriff zu schützen. So braucht heute jedes Dorf, [S. 32] jedes Bauernhaus einen Hüter, der seine charakteristische Schönheit vor den Verwüstungen eines alles gleichmachenden Kultur schützt. Wie viel wurde in dieser Hinsicht schon gesündigt. „Was seit einem halben Jahrhundert im Dorfe neugebaut worden ist, entehrt zumeist den Bauer und das Dorf und ist durchweg unwürdig, eine ruhmreiche mehr als tausendjährige Tradition weiterzuführen. Der Bauer selbst weiß heute nichts mehr von seinen Vätern und ihrer ehrlichen und ehrbaren Bauweise und das Bauhandwerk im Dorfe, das einst schlicht und sachgemäß, echt und – eben um dieser Eigenschaften willen: ‚schön‘ den Hausbau besorgte und die innere Wahrhaftigkeit des Dorfbildes durch Jahrhunderte hin zu garantieren vermochte, es lebt heute nicht mehr.“8
Wie das Sinnen und Trachten des Bauern, so verstädtert sich auch das Dorf immer mehr. Ein Umbau nach dem andern entsteht, jeder nach derselben städtischen Schablone. Ein Steinkasten, große Spiegelfenster, Terrakottaumrahmungen, ein mächtiges Tor mit Messinggriffen, oben geziert mit bunten Gläsern, vorne ein Garten, auf Ziegel ein geschwungenes eisernes Gartengitter, im Garten zierliche Rabatten, in deren Mitte manchmal als größte Errungenschaft ein Terrakottazwerg, der ein Fühlhorn trägt, oder „nur“ ein Rosenbäumchen – und das Ganze vielleicht ein besserer Vorort der Großstadt? Gott bewahre! Ein Weinbauernhaus im Retzer Weinlande! Das Innere des Hauses ist natürlich entsprechend. Die alte, trauliche, gemütliche Stube mit dem mächtigen Tisch mit stets weißgescheuerter Platte und den Wandbänken herum ist verschwunden. Verschwunden der Ofen mit seinen wärmenden Kacheln und den Bänken herum. Verschwunden die gemalten Glasbilder an den Wänden, das Tellerbrett mit seinen bunt verzierten Tellern und Schüsseln und glasierten Tonkrügen, verschwunden der alte Kasten mit seinen roten und blauen Blumen auf den Türen, verschwunden die Sessel mit ihrer eigenartigen Rückenlehne, die ihre Füße immer aus- [S. 33] einanderspreizten, wie Matrosen, wenn sie nach langer Seefahrt zum erstenmal aufs Land gehen, verschwunden die behäbigen Truhen mit ihrem reichen Inhalt. Verschwunden ach so manches andere noch, was einst die Stube so lieb und traut machte. Dafür ist ein „Zimmer“ da. Wanderer, tritt mit Ehrfurcht ein! Gedämpftes Licht umfängt dich, wozu hätte man im Kriege rote Stoffvorhänge eingehamstert. An der Wand ein paar moderne Betten mit Walzenaufsätzen, ein Nachtkästchen daneben, sogar ein Waschtisch steht da, nur stehen jetzt, damit er auch seinen Zweck erfüllt, eine Lampe und ein paar künstliche Blumenstöcke und ein Paar neue Schuhe friedlich nebeneinander darauf. Zwischen den Fenstern steht ein Gläserkasten, und wenn wir näher treten, möchte es uns um den Gesellen leid tun in dieser Umgebung. Er ist aus Nußbaumholz mit schönen Barockschnitzereien. Ein Altertumshändler würde über ihn in Entzücken geraten. Weil wir ihn so sehen, meint die Bäuerin entschuldigend: „Der ist noch von der Ahnl her und soviel praktisch halt. Da kann man mit der Hand bis hinauf langen, bei die neuen braucht man immer einen Sessel.“ Diesem Umstand hat er es also zu verdanken, daß er noch am Leben ist. Dafür hat sich ein anderes Stück hereinverirrt, das nun mit Stolz gewiesen wird – ein moderner Diwan. „Da müssen’s schaun. Der hat aber auch was gekostet.“ Das Geld, heute der einzige künstlerische Wertmesser im Bauernhaus! Wo ist der alte Großvaterstuhl mit den großen Seitenlehnen, wo man so wohlig sitzen konnte. „Ach der ist oben am Boden. Müßte man sich schämen, wenn jemand hereinkommt und das Möbel sähe.“ An den Wänden hängen die Bilder. Ein paar religiöse Öldrucke letzter Güte, zwei große Bilder, bei denen der Rahmen das kostbarste ist – ein Hochzeitsgeschenk. Im Winkel ist der vom Rauch geschwärzte Herrgott geblieben. Sinnend blicke ich hinauf. Wie viele Generationen mögen zu dir hinauf geschaut haben, wie manche junge Ehefrau mag vor dich hingetreten sein, wenn sie zum erstenmal ins Haus kam, und sich deinen Segen erbeten haben, [S. 34] wie oft mag die Familie da gekniet sein, wenn draußen Schauer und Wetter niedergingen. Da preßte sich wohl die Hand zusammen und das Auge suchte dich. „Lieber Herrgott, jetzt laß uns nicht im Stiche.“ Wie manchmal kniete die junge Mutter vor dir, wenn Fieberröte des Kindleins Wangen überzogen hatte und der Tod ans Fenster klopfte. Wie oft magst du auch auf ein wachsbleiches Antlitz niedergeschaut haben, das zu deinen Füßen aufgebahrt lag, bis dann der Vorbeter in des Toten Namen an der Türschwelle rührend Abschied nahm von der ganzen „Freundschaft“ und ihr in des Toten Namen alles abbat. Geschlechter sind gekommen und gegangen, du warst der segnende und schützende Geist im Hause, in Zukunft wird man dich wohl besonders brauchen! Auf einer anderen Seite hängen in modernen knallroten Faltpapierrahmen gefaßt zwei Landschaftsbilder. Was sie vorstellen, weiß niemand im Hause, daneben ein Erinnerungsbild an die Dienstzeit des Hausherrn nach bekanntem Muster – Dutzendware einer unternehmenden Firma. So das Bauernhaus der Neuzeit im Innern, diesmal aus dem Süden Niederösterreichs. Ja, haben denn die Leute gar keinen Geschmack, möchte mancher hin und wieder entsetzt ausrufen. Gewiß, sie hatten ihn, aber er wurde ihnen planmäßig genommen, immer und in allem wurde ihnen die Stadt als Vorbild hingestellt, ihre Eigenart, das Schöne ihrer Behausung lehrte sie niemand schätzen und lehrt es sie auch bis heute noch niemand. In den slawischen Ländern greift man in Zeichenvorlagen, in Stickereien und Häckelarbeiten, in ländlichen Kunstarbeiten bewußterweise auf die im Volke lebende Kunst zurück. Bei uns redet man beständig vom „bodenständigen Unterricht“ und unterrichtet weiter nach städtischer Schablone.
Welch unendliches Arbeitsfeld für den Dorfpfarrer, wenn er auch ein Schützer der Heimat werden will, damit sie nicht ihr eigenes Gepräge verliere und untertauche im allgemeinen Schema. Nur ein paar Gedanken seien dazu erwähnt. Außerhalb des Ortes steht eine mächtige Buche. Jahrhunderte [S. 35] sind an ihr vorübergegangen, sie sah Türken und Franzosen vorbeiziehen. Die Kinder des Dorfes haben zu ihren Füßen gespielt, die Alten an ihren Stamm gelehnt ihre Erfahrungen ausgetauscht. Der hohe Holzpreis hat auch sie zum Tode verurteilt. Wäre sie nicht des Erhaltens wert! Wenn man dem Besitzer zeigt, welch geistiger Wert in dem Baum steckt, seinen Stolz weckt, daß weit und breit kein gleicher Baum ist, den geringen materiellen Nutzen dagegenhält, auf den er doch nicht anstehen werde, dann ist der Baum beinahe immer gerettet und ein Stück Naturschutz geübt.
Dem Pfarrer untersteht das Heiligtum des Dorfes, die Kirche. Die neue Zeit pocht auch an die Pforten des Heiligtums. Gerade aber die Kirche umfaßt so viel an Stimmungswerten, gibt oft der ganzen Gegend ein so charakteristisches Gepräge, daß man bei Änderungen doppelt besorgt sein muß. Wie manche Kirche ist aus lauter Restauriererei und Stilfanatismus um ihre ganze Eigenart gekommen. Unsere Landkirchen brauchen kein Typus für Gotik oder Barock zu sein, sondern eine Herzensheimat für die ganze Gemeinde. Darum hat auch jede Zeit an ihnen ihre Denkmäler hinterlassen, oft auch, das muß man ruhig zugestehen, mehr guten Willen als Geschick gezeigt. Warum alle diese Spuren vergangener Zeiten tilgen, ein Bild, eine Statue entfernen, weil sie nicht künstlerisch sind! Wie viele haben vielleicht gerade vor diesen ihren Trost gefunden, darum haben sie auch ihr Recht im Gotteshause. Wie ganz anders spricht auch dies Alte, an dem irgend ein Meister mit Herzensbegeisterung gearbeitet, zu uns als die moderne, religiöse Fabriksware. Ist eine bedeutendere Änderung notwendig, dann wird das Staatsdenkmalamt in Wien, VIII., Auerspergstraße 1, gerne mit Rat zur Verfügung stehen, dann werden aber auch Fälle vermieden werden, daß ein mittelalterlicher Gobelin zu Hausschuhen verarbeitet wird oder ein Bild von Lukas Cranach zu einer Türe oder daß ein profitgieriger Händler eine Statue von unersetzlichem Wert verschleppt und verschachert. „Liebet eure Kirche,“ sagt darum [S. 36] ein bekannter christlicher Kunstkenner, „liebet eure Kirche mit einer wahren Liebe, wie der Vater sein Kind liebt. Er behängt es nicht mit allerlei echtem und falschem Schmuck, sondern nimmt sich seines Herzens und Charakters an. Je tiefer ihr euch in den Sinn dessen versenkt, was die Vorfahren für die Kirche geleistet, je mehr ihr verstehen lernt, daß sie nichts geschaffen, was nicht mit Kopf und Herz wohl überlegt war, desto mehr werdet ihr euch scheuen, ihr Werk anzutasten, desto mehr werdet ihr aber auch, wenn euch selbst eine ähnliche Aufgabe erwächst, mit Behutsamkeit und mit schwerem Verantwortlichkeitsgefühl gegen eure Gemeinde, gegen eure Kirche und gegen die Nachwelt daran gehen.“9
Wie sehr die moderne Zeit ins Bauernhaus schon eingedrungen, wie viel Unheil sie da schon angerichtet, haben wir schon gesehen. Fuhrenweise haben gerissene Altertumshändler schon die besten Sachen aus den Bauernhäusern weggeschleppt und elenden Schund dafür hineingebracht. Da sind aufklärende und mahnende Worte wohl am Platze. Immer wieder muß man den Bauer auf die Schönheit und Gediegenheit alter Stücke aufmerksam machen, sie ihm zu einem Herzensgut machen, dann werden sie in seinen Händen gesichert sein. Einst erzählte mir ein Bauer, daß er willens sei, seinen schönen geschnitzten Stubenboden zu entfernen. Es wäre schade gewesen darum. Kurz entschlossen sagte ich darum: „Dann verkaufen Sie ihn mir.“ „Ja, was machen denn Herr Pfarrer damit.“ „Ich lasse ihn mir hinaufmachen, denn einen so schönen Boden bekomme ich nicht gleich wieder!“ Heute noch ist der Boden an alter Stelle. Wieviel an alter charakteristischer Bauweise, wie an der Hausanlage, an den gekreuzten Roßköpfen an den Giebelenden, erinnert noch an die älteren Zeiten. Jahrhunderte hat es überdauert, unsere pietätslose Zeit sollte es zugrunde richten, um etwas ganz Fremdes an die Stelle zu setzen! Wir müssen vielmehr gegen die eindringende Geschmackslosigkeit im Bauernhaus ankämpfen. Findet der Bauer in seinem Hause keine [S. 37 ] Bauernheimat mehr, dann verstädtert er rettungslos, rettungslos aber auch seine Kinder. Leider wird von Seite der Behörden dieser Frage noch viel zu wenig Gewicht beigelegt. Baumeister und Zimmermeister bringen unseren Bestrebungen das wenigste Interesse entgegen, weil sie fast immer nur nach städtischer Schablone vorgebildet werden und danach auch nur arbeiten. Die Vorbildung der Handwerker für ihr Wirken auf dem Lande liegt noch sehr im Argen. Will man dem Bauer Freude an seinem Heim, seiner Bauweise, seiner Tracht beibringen, dann muß ganz anders gearbeitet werden. Worte allein vermögen gegen die andrängende Sturmflut anderer Eindrücke nichts mehr. In Lichtbildervorträgen, in Veranstaltungen und Führungen muß ihm immer und immer wieder die Schönheit seiner bäuerlichen Eigenheit gegenüber der Großstadt zum Bewußtsein gebracht werden, bis es endlich zum geistigen Eigentum wird. Da ist noch viele Arbeit für die Zukunft zu leisten.
Ein Bild des Jammers ist heute auf dem Lande sehr oft der Friedhof. Ich kam einst auf den Friedhof einer Dorfgemeinde, den ich in meiner Jugend viel besucht hatte. Früher war es ein trautes, stilles Plätzchen. Holz- und Eisenkreuze, hie und wieder ein Grabstein, auch nicht größer als die anderen Kreuze, in der Mitte das schöne Friedhofskreuz, der Herr allen sichtbar, ein Sinnbild des Opfers und der Auferstehung. Jetzt aber tut mir das Herz weh. Protzige zwei Meter hohe schwarze Granitsäulen mit weithin funkelnden goldenen Buchstaben, die hinausschreien mußten, daß hier Herr N. N. liege, der im Leben Geld genug gehabt habe, sich solch ein Denkmal zu verschaffen. Rund herum eine Einfassung aus demselben schwarzen Granit, als ob der Tote noch jetzt hartherzig jede Berührung mit dem gemeinen Volke abwehren wollte. Kommt mir nicht zu nahe, ich bin der reiche N.! Und so gings im ganzen Friedhof weiter. Kein einziges auch nur halbwegs künstlerisches Monument, nur die tote Masse, die durch reine Massigkeit wirken mußte, daneben wieder eine furchtbare Öde, ein Kreuz aus [S. 38] Gußeisen nach dem andern. Im Vorbeigehen hatte ich sie an der Türe des Kaufmannes lehnen gesehen, nur der Name daraufgemalt und der Pietät ist Genüge geschehen. Einige hatten sich auch einen besseren Anstrich geben wollen, und da das Geld auf einen Grabstein nicht reichte, ein Kunstwerk aus Zement errichtet, das mit seinem steinernen Palmzweig um das Kreuz schrecklich wirkte. Seit man die Friedhöfe von den Kirchen getrennt, hat man ihnen die Seele genommen. Wo ist heute noch die schöne christliche Idee von der Ruhe, des Geborgenseins in Gottes Nähe, der christlichen Liebe, für die alle Brüder sind. Wozu die Ungleichheiten im Leben auch noch in diese Stätte hineinzerren! Muß es der Protze den armen Kindern, die zu Vater oder Mutters Grab kommen, auch nach dem Tode noch vorschreien, daß ihr lieber Toter ein armer Hascher war. Unseren Friedhöfen tut wieder mehr Gefühl not. Wie schön waren die alten geschmiedeten Grabkreuze mit dem auferstandenen Heiland an der Spitze? Das war Glaube, das war Kunstsinn! Nehmen wir den Kampf gegen die Öde, gegen das Protzentum im Friedhof auf. Bei der Bevölkerung findet man bald Widerhall. In unserem Friedhofe stehen schon mehrere Holzkreuze in den verschiedensten Formen. Sehr schön sind einfache Birkenkreuze mit einem Heiland darauf. „Auf den Ort müssen wir besonders schauen,“ hat mit einst ein Bauer gesagt, „denn da kommen wir alle hin.“
Bei einem Volksfeste findet ein Trachtenfestzug immer den größten Anklang. Mir kommt dieses Gefallen der Städter oft selbstsüchtig vor. Wie sie zur Erholung eine schöne Gegend suchen, so wollen sie auch zur Staffage anders gekleidete Menschen dazu als in der Stadt. Es ist über die Wiederbelebung der Volkstracht schon viel gesprochen und geschrieben worden. Heute herrscht in unserem Volke hier im Wechselgebiet noch gar kein Verständnis für seine einstige Volkstracht. Sie ist ganz in Vergessenheit gekommen, und wenn ich unseren Leuten Bilder aus den Sechzigerjahren mit der Volkstracht zeigte, erklärten sie diese als „Tiroler“. Heute, [S. 39] wo alles unter dem Banne der Mode und damit der Stadt steht, könnten wir bei Wiederbelebung der Volkstrachten nur erreichen, daß sie ein Halbjahr „modern“ wären, dann aber wären alle Bestrebungen vorbei. Ist eine Gegend noch so glücklich, eine Volkstracht zu besitzen, dann erhalte man sie mit aller Kraft, sie es immer wert. Ist sie verschwunden, dann, glaube ich, gibt es nur einen Weg, sie in Ehren zu bringen, sie muß zur Festtracht erhoben werden. Wie Pfarrer und Militärsmann ihr Amtskleid tragen, so muß der Bauer bei feierlichen Anlässen in seinem Feierkleide, in der heimatlichen Tracht wieder erscheinen.
Die Gebundenheit, die früher das Leben des Bauern beherrschte, zeigte sich besonders auch in Sitte und Brauch. Alles war durch das Herkommen geordnet. Mancher schöne Gedanke hatte durch die Länge der Zeit Gesetzeskraft erhalten und wirkte sehr segensreich. Sitte und Brauch erzogen zur Sittlichkeit. Oft hatten diese Lebensregeln auch einen religiösen Hintergrund. Wenn ein Mädchen pfeift, sagt der Volksmund, weint die Mutter Gottes. Wer eine Tür zuschlägt, quetscht eine arme Seele ein, wer Brot unachtsam auf die Erde streut, muß am jüngsten Tage dafür glühende Kohlen sammeln, die aus den Brotbröseln geworden sind. Mit der fortschreitenden Auflösung der Dorfgemeinschaft droht auch Sitte und Brauch und damit viel seelisches Gut zugrunde zu gehen. Welch geistige Armut müßte dann ins Dorf einziehen. Schützen und erhalten wir alten Brauch und alte Sitte, soweit sie es nur irgendwie würdig sind. Gewöhnlich hält der Bauer vor dem Gebildeten mit seiner Sitte zurück, weil er sich vor ihm scheut, wenn er aber sieht, wie gerade der Pfarrer, auf dessen Urteil er doch sonst viel gibt, die alten Sitten ehrfurchtsvoll behandelt und an ihnen Freude hat, dann wird auch er seine Sitten höher schätzen und sie gewiß nicht so leicht opfern. Ein tiefer Sinn liegt in den alten Bräuchen, sagt der Dichter, man soll sie ehren! Der Pfarrer sei darum Schützer und Förderer der alten Sitte, ja er greife ruhig selbst tätig ein, um sie zu erhalten oder wieder ins Leben [S. 40] zu bringen, und er wird im Herzen des Volkes, wenn es nicht schon ganz materialistisch geworden, immer Widerhall finden. Eines aber muß stets vermieden werden, die Volkssitte soll für das Volk eine Herzenssache sein, aber kein Schaustück für andere, keine Unterhaltung für sensationslüsterne Sommergäste. Möge die Volkskunde nur nicht zu viel tun in der Popularisierung der Volksbräuche, sonst ist ihr Untergang besiegelt. Das Volk ist in seinem Empfinden keusch und würde eine Entweihung nicht ertragen. Vom ganzen Herzen stimme ich Geramb bei, wenn er schreibt: „Die Sitten und Bräuche unseres eigenen Volkes sollten uns doch wohl so heilig sein, daß man sie nicht auf eine Schaubude stellt. Es gibt nichts, was mein Volksempfinden mehr verletzen könnte, als eine Gschnasgesellschaft mit ‚Original-Bauerntänzen‘ und eine ‚konzessionierte Volksschauspielunternehmung mit Originalkostümen.‘“10
Immer mehr werden auch die alten Lieder durch großstädtische Couplets oder gar durch die Kriegszotenlieder verdrängt. In Vereinsunterhaltungen lasse sich die alten Lieder wieder zum Aufleben bringen, ja, ich habe bei manchem Zusammensein mit Bauern diese so lange gebeten, bis sie wieder die alten Lieder anfingen zu singen und die Jüngeren haben es dann von ihnen gelernt. Am besten haben sich noch die geistlichen Volkslieder mit ihren innigen Melodien erhalten, möchten sie doch gesammelt werden, bevor sie in Vergessenheit kommen.
Gedenken muß ich hier auch noch unserer Tätigkeit zur Erhaltung der Volkssprache. Auch diese macht einen unverkennbaren Verstädterungsprozeß durch, einmal in der Aussprache, dann in dem Eindringen städtischer Wörter. Wie notwendig für einen Dorfpfarrer die Kenntnis der Umgangssprache seiner Leute ist, bedarf keiner Erläuterung. Jeder Krankenbesuch, jeder Schulunterricht überzeugt uns aufs neue davon. Der Dialekt ist ja, wie Goethe mit Recht sagt, das Element, in dem die Seele ihren Atem schöpft. Die Schriftsprache [S. 41] ist dem Kinde fremd, vieles bleibt ihm unverständlich, wenn nicht der Katechet gleich für den Schriftausdruck erläuternd daneben das Dialektwort gebraucht. Viel kann der Pfarrer für die Mundart tun, wenn er sie sammelt und aufzeichnet. Die Akademie der Wissenschaften (Wörterbuchkommission) in Wien IV/50 wird die Mitarbeit an dem Wörterbuch der bayrisch-österreichischen Mundart mit Freude begrüßen. Gerade der Klerus ist bisher noch viel zu wenig dabei vertreten.
Ist manches altertümliche Gut, das durch schöne Ausführung oder durch seine Eigenart hervorragt, an seinem Aufenthaltsorte zu sehr gefährdet, dann sammle man es als Grundstock für ein Heimatmuseum. Ist ein Mitbruder photographiekundig, dann wird er der Heimatkunde die besten Dienste leisten, wenn er jedes einzelne Bauernhaus, die Kirche, den Friedhof mit schönen Grabdenkmälern, bemerkenswerte Hauseinrichtungsgegenstände oder Wirtschaftsgeräte, Volkstrachten, Volksgebräuche im Bilde aufnimmt und zu einem Heimatsbilderbuch vereinigt.
So haben wir gesehen, wie der Dorfpfarrer auch als Schützer von Heimat und Volkstum wirken kann. Wie oft aber wird es ihm zur traurigen Erkenntnis werden, wie viel geistiges Gut im Volksleben uns schon verloren gegangen ist. Da heißt es nun Neues schaffen, eine neue Dorfheimat erstehen lassen und damit kommen wir zur Tätigkeit des Pfarrers als schaffender und neu gestaltender Volksbildner.
Immer wieder hat in den bisherigen Ausführungen der Gedanke durchgeklungen, alle Arbeit, alles Schaffen, alles Studieren, Sammeln und Suchen darf nicht Selbstzweck werden, sondern muß anderen zum Nutzen sein. Dienstbar wird das eigene Wissen und noch mehr die reichen Innenkräfte des Pfarrers aber nur durch die rechte Volksbildungsarbeit.
Volksbildungsarbeit! In der letzten Zeit war dieser Name etwas in Verruf gekommen. Manche glaubten, das Wesen der Volksbildung liege darin, dem weniger Studierten möglichst [S. 42] viel Wissen vorzuführen. Vorträge aus oft ganz entgegengesetzten Wissensgebieten folgten einander, ein Wissenssturm fegte über die Zuhörer hin, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen, höchstens den Dünkel, nun auch gelehrt zu sein. Andere betrachteten die Volksbildungsarbeit als eine Art geistiger Almosenspenderei, wo sie dem armen ungebildeten Volke großmütig einen Brocken ihrer Gelehrsamkeit hinwarfen. Das ist uns heute Volksbildungsarbeit nicht! Das wäre ihr Zerrbild. Wahre Volksbildung ist uns heute kein Wissensverschleiß mehr. Nicht gescheite, sondern gute Menschen wollen wir bilden. Darum wird Volksbildungsarbeit nicht mehr ausschließlich mit dem Kopfe, sondern vor allem mit dem Herzen betrieben und nicht zum Kopfe allein will sie sprechen, sondern besonders zum Herzen. Sie will Herzens-, Willens-, Lebensarbeit leisten. Das muß ihr Endzweck sein, auf den alles hingeordnet ist. Natürlich läßt er sich nicht auf einmal und in seiner idealen Höhe nur bei ganz Auserwählten erreichen, aber Herz und Wille sollte nie ganz leer ausgehen.
Will nun unser Landvolk diese Bildungsarbeit, hat es nicht ganz andere Interessen? Ja, ganz gewiß, das gestehe ich sofort zu, aus den Kreisen des Landvolkes ist noch kein Ruf nach Lebenserneuerung ergangen. Und würde man warten, bis er erklingt, dann wäre es wohl schon der Todesschrei eines Untergehenden, dem Volksbildungsarbeit auch nicht mehr helfen könnte. Unser Bauernvolk verlangt nach keiner Umbildung seines Lebens, weil ihm bis heute noch wenig zum Bewußtsein gekommen ist, woran es krankt. Jahrzehntelang hat man dem Bauer die Stadt mit ihrer Kultur als das höchste Ziel vor Augen gestellt und heute, wo es mancher Bauer erreicht zu haben vermeint, da sollte es der Quell alles Unglücks sein. Da wird uns kein Bauer verstehen. Er wird nur eine Feindseligkeit der „Studierten“ dahinter wittern. Zuerst müssen wir ihn daher zur Erkenntnis bringen, daß der eingeschlagene Weg zum Untergang des ganzen Bauerntums und damit auch seiner eigenen Zukunft [S. 43] führt. In vielen Bauern lebt diese Erkenntnis heute schon gefühlsmäßig. „Das verfluchte Geld,“ hat mir unlängst einer erklärt, „ist an allem schuld.“ Ist diese Erkenntnis erst einmal durchgedrungen, sieht der Bauer, mit wieviel Gutem und Schönem er seinen Niedergang erkauft hat, wie nicht in der wahllosen Nachahmung der Stadt, sondern nur in der Pflege seiner eigenen gediegenen Kultur, in Anlehnung an einen gesunden Fortschritt sein Heil besteht, dann wird er auch für alle Volksbildungsarbeit zu haben sein.
Die Volksbildung hat daher zwei Aufgaben: dem Landvolk die Augen für die Schäden der heutigen Zeit zu öffnen und ihm einen Weg für eine bessere Zukunft zu zeigen.
Wie wäre dies zu erreichen? Hastlos und rastlos. Wer mit den höchsten Anforderungen an das Landvolk herantreten würde, wäre eines Mißerfolges gewiß auch sicher. „Gut Ding braucht Weile.“ Jedes Ding muß sich einleben und auf dem Lande braucht es besonders lange dazu. Die Volksbildungsarbeit muß Wurzel schlagen können im dörflichen Leben. Der Bauer muß erkennen, daß man es gut meint mit ihm. „Die Liebe geht durch den Magen,“ sagt ein altes Volkssprichwort, darum kann auch unsere Bildungsarbeit vorerst keine rein idealen Ziele verfolgen, sie muß an den Beruf des Landmannes anknüpfen, Berufsbildungsarbeit leisten, ländliche Wohlfahrtspflege treiben. Die Not in materieller und sanitärer Hinsicht ist auch auf dem Lande sehr groß. Hilfsbereit wird der Pfarrer bei allen Bestrebungen zur Linderung mittun.
Sieht das Volk, daß ein Pfarrer ein offenes Herz für seine Leiden hat, daß es bei ihm Verständnis findet und daß er gerne helfen will, wo er kann, dann wird es ihm auch sein Herz entgegenbringen und nun erst kann eine wahre Herzens- und Willensbildung einsetzen. Doch die darf, um alles in der Welt, keine Schablonenarbeit werden. Wenn irgendwo das Herz und die Liebe die Führung haben müssen, dann gewiß da. Wenn der Volksbildner Wesen von seinem Wesen gibt, Feuer von seinem Feuer, dann werden die Herzen [S. 44] warm werden und der Gedanke, der ihn begeistert, wird auch zünden in den Herzen der anderen.
Als Ziel der ländlichen Volksbildungsarbeit haben wir die Aufgabe erkannt, dem Landvolke einen Weg zu einer besseren Zukunft zu zeigen, und die kann nur in der gesunden Wiederbelebung des bäuerlichen Volkstums bestehen. Jede Erneuerung muß aber von innen heraus kommen, einen anderen Menschen schaffen. An dem materialistischen Geiste leiden wir. Materialismus kann nur durch Idealismus bekämpft werden, der die Seele nicht ans Irdische bindet, sie über alles Irdische erhebt. Und dieser gesunde, Segen und Leben bringende Idealismus liegt für uns im Christentum verkörpert. Wir müßten überzeugungslos und geistlos sein, wenn wir bei all unserer Arbeit nicht immer wieder auf die ewigen Ideen zurückgriffen, aus denen wir selbst Kraft und Begeisterung schöpfen. Christentum hat das Dorf wohl bisher gehabt, doch in vielen Herzen ist es tot geworden, zum bloßen Brauch heruntergesunken, den man mitmacht, solange man im gewöhnlichen Geleise lebt. Diese Religion ist nutzlos für uns. Das ist totes Buchstabenchristentum, aber kein Geist und Leben. Wir müssen das Christentum in jedem einzelnen Herzen wieder zum Leben bringen, jeder einzelne muß sich seines Verhältnisses zu Gott bewußt werden und darüber Rechenschaft geben lernen. Gottes Gebote müssen ihm klar werden als Grundlage für alles Menschenglück. Wir brauchen ein Leben nicht nach dem Glauben, sondern wie der Apostel sagt, aus dem Glauben heraus, ein Durchdringen des praktischen Denkens und Handelns mit dem lebendigen Geiste des Christentums. Es geht nicht an, daß der Bauer, wie heute, die sechs Wochentage oft Materialist und am Sonntage in der Kirche Idealist ist. Die besten Anweisungen für diese religiöse Wiedergeburt bietet Heinen in seinen ausgezeichneten Büchern. Gute Dienste leisten auch die lieben Schriften von H. Mohr.
Machen wir unsere Gotteshäuser zu einer wahren Dorfkirche. „Es gibt keine Sonntagsevangelium,“ sagt Heinen, [S. 45] „das nicht einen verklärenden Schimmer auf das Wirklichkeitsleben in Familie, Arbeit, Gemeinschaft würfe. Es ist eine ungemein dankbare Aufgabe, die Werte, die darin enthalten sind, für das Landvolk herauszuholen und lebendig zu machen. Der Bauer lebt mit dem Kirchenjahr.“11 Lassen wir darum die Dorffesttage auch in die Kirche hereinklingen und die Kirchenfeste auch ins Dorfleben hinausklingen. Wie schön ist nicht ein Choral vom Kirchturm geblasen, wenn die Töne der Abendglocke bereits verklungen sind und der Gedanke des kommenden Festtages bereits die Menschenherzen höher schlagen läßt. Machen wir dem Bauer seine Kirche auch heimisch. Wo sind heute oft die lieben Bauernheiligen. Der Bauer lebt ja mit seinen Heiligen. Für Feuer und Wasser, für Feld und Wald und Weingarten, für Bienen und Haustiere, überall hat er einen eigenen Beschützer. Nur in der Kirche findet er sie nicht, die ist angefüllt mit landfremden Heiligen, zu denen er in kein näheres Verhältnis kommen kann. Wie manche neue Andacht wurde schon eingeführt und konnte doch im Volke keine Wurzel schlagen. Pflegen wir lieber die schönen alten Andachten.
Jeder Landbewohner hat auch Pflichten gegen seine Umgebung, sei es im engen Verband der Familie oder des Dorfes, sei es im weiten des Volkes und Staates. Das alte, schöne Familienleben auf dem Dorfe droht ebenfalls ein Raub der neuen Zeit zu werden. Zwar war auch in alter Zeit nicht alles Gold, was da glänzte, und manches Familienleben war gewiß kein Ideal, heute aber sind mit Wirtshausbesuch, Vergnünungssucht, Unbotmäßigkeit, Selbstsucht gar viele Erschwernisse dazu gekommen, die eine richtige Familienpflege als Gebot der Volksbildungsarbeit erscheinen lassen. Die Familie hat man mit Recht die Keimzelle des Staates und des ganzen Volkes genannt. Ihr muß auch auf dem Lande viel mehr Beachtung zuteil werden. Alle Vorbildung der werdenden Familienväter und Mütter erfolgte bisher im Schoße der elterlichen Familie. Wie aber, wenn diese selbst [S. 46] krank war! Und selbst im besten Falle, wie mangelhaft war nicht diese Vorbildung vor allem bei den Mädchen. Wie spärlich sind ihre Kenntnisse in der Kochkunst und gerade das Bauernhaus mit seiner Fülle von Nahrungsmitteln gäbe die beste Gelegenheit dazu. Und ist ein Kranker im Haus, was muß man da auf dem Lande alles erfahren. Diese Scheu vor Luft und Wasser, die ungeschickte Behandlung, die wohl das Beste will, es aber nicht ausführen kann, die Unfähigkeit, dem Kranken eine zukömmliche Kost zu bereiten! Wie wenig Aufmerksamkeit wird der Säuglings- und Kinderpflege gewidmet! Wo fände eine Bauersfrau die notwendige Zeit, wird man mir entgegenhalten. Gewiß, sie ist mit Arbeit überhäuft, aber warum können es so viele und andere in denselben Verhältnissen eben nicht? Hat die Bauersfrau wenig Zeit, dann muß sie erst recht die notwendige Vorbildung und später die beständige Förderung erhalten, um gleich das Richtige zu treffen und ihre karge Zeit gut ausnützen zu können. Wie ganz anders könnte manches Bauernhaus sein, wie reinlich, nett und traut, wenn seine Herrin nur etwas mehr auf Ordnung hielte. Wie kann ich mein Heim gemütlich und wohnlich gestalten, das wäre manches Thema für einen Volksbildungsabend (vgl dazu A. Heinen, die Familie).
Aus der Familiengesinnung muß sich die Bürgergesinnung entwickeln, zunächst im engsten Raume, im heimatlichen Dorfe. Mit der Lösung der alten Fesseln ist vielfach auch der alte Gemeinschaftsgeist geschwunden. Ohne Gemeinschaftsgeist aber kein Dorfleben! Ansätze zu neuen Bindungen zeigen sich bereits. Gemeinsame Not hat heute die meisten Bauern zu genossenschaftlichem Zusammenschluß gebracht. Warum sollte dieses Zusammenhalten nur aus materiellen Gründen möglich sein! Läßt sich der Blick nicht weiter spannen, daß wir endlich über die Schranke der Selbstsucht, die auch da uns hindert, hinwegkommen. Soll ich dem andern nur dann helfen, wenn er mir wieder helfen kann? Allmählich läßt sich die Anteilnahme immer weiter dehnen, auf die [S. 47] großen Verbände, denen der Bauer bisher meist teilnahmslos gegenüber gestanden, auf Volk und Vaterland. Erst wenn der Bauer sich hineingestellt sieht als ein Glied ins Ganze, wenn ihm das Verständnis dafür erschlossen, dann wird er sich auch als Glied seines deutschen Volkes, als Sohn seines Vaterlandes fühlen.
Verankern wir ihn auch fest in der heimatlichen Erde. Die Liebe zur Heimat liegt ja ohnehin in so vielen Herzen der Landbewohner, nur fühlt er es erst, wenn er in der kalten Fremde weilt und von verzehrender Sehnsucht nach der Heimat – Heimweh nennt es der Deutsche gemütvoll – ergriffen wird. Diese stille Anhänglichkeit an die Heimat ist uns die beste Hilfe im Kampfe gegen die Entwurzelung des Bauernstandes. Der Bauer muß Freude bekommen an seiner Heimat. Sie muß ihm wohl vertraut werden mit all ihren natürlichen Reizen und ihrer Eigenart, mit ihrer Sage und Geschichte, mit ihrer Sprache und Volkssitte, dann wird sie seine „Heimat“, wo er wirklich zu Hause ist, dann wird er all ihr Gut schätzen, weil er es zu schätzen versteht.
Das wären unsere Hochziele. Noch einmal sei betont, nicht auf einmal, ja nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten vielleicht erst lassen sie sich erreichen. Nicht immer wird auch ernste Volksbildungsarbeit möglich sein. Wie oft fehlen die geeigneten Leute, die die Anregungen willig aufnehmen und verarbeiten, oft fehlt die geeignete Stimmung, dann müssen wir einen weiteren Weg einschlagen, um zum Herzen des Volkes zu kommen. „Der kürzeste Weg ist oft nicht der beste,“ sagt das Volk selbst. Anklang wird da immer die gediegene Volksunterhaltung finden. Wie viel Gschnas hat sich hier heute breit gemacht. Die Unterhaltung zeigt uns erst recht, wie tief wir jetzt stehn. Nirgends ist die alte Dorfsitte so vollständig zusammengebrochen wie da. Vielleicht war es auch ein doppelter Schaden, daß die Älteren und Gesetzteren sich davon zurückzogen und den Jüngeren wahllos das Feld überließen. Wo sind die alten Volkstänze und Spiele, wo die lieben Volkslieder, wo harmloser Scherz und Frohsinn [S. 48], wo die erfreuenden Klänge der Hausmusik geblieben? Heute ist Trunk und Tanz und Kartenspiel das einzige Vergnügen, das Wirtshaus die einzige Stätte der Volksunterhaltung. Ein Grammophon kräht zum hundertsten Male seine öden Gassenhauer und städtischen Schlager herunter und der ganze Chorus stimmt dazu ein. Samstag und Sonntag ladet das Kino zum Besuch ein und bietet in seinen dunstigen Räumen das „Neueste“, was in der Stadt schon längst nicht mehr zugkräftig ist, das Programm natürlich „für das Land hergerichtet,“ das heißt noch roher und gemeiner als im Vorstadtkino. Die besseren Landbewohner fühlen sich natürlich zurückgestoßen und manche suchen dafür in der Stadt „bessere Unterhaltung“. Den anderen Teil des Vergnügens schafft der Wirt, dessen einzige Sorge oft nur ist, ein glänzendes Geschäft zu machen. Da wird die Alkoholpest großgezüchtet, die heute zum Krebsschaden für das Land geworden ist. Stünde der ländlichen Volksbildung nur der zehnte Teil aller Summen zu Gebote, die unnütz für den Alkohol hinausgeworfen werden, wir könnten aus dem Lande ein Paradies machen. Und die sittliche Verwilderung, die diese Pest zur Folge hat! Eine einzige wüste Unterhaltung vernichtet die Kulturarbeit eines Jahres und macht viele für edlere Einflüsse überhaupt unzugänglich. Statt leerer Kritisiererei, die noch nie Positives geschaffen, bieten wir lieber dem Volke Gediegenes! Freude auf das Dorf – das muß die Losung jeder Volksunterhaltung werden. Gerade dieser Punkt ist für den Geistlichen wohl sehr schwierig. Soll er als Veranstalter vorangehen, sich allen Anwürfen aussetzen? – ausgeschlossen. Sich von jeder Veranstaltung zurückziehen, das hieße die guten Elemente, die noch vorhanden sind, des einigenden Mittelpunktes berauben und der Roheit Tür und Tor öffnen. Am besten wird es sein, sich im Dorfe einen Kreis angesehener Männer und besserer Burschen zu sammeln und ihnen nun die Führung zu überlassen, selbst aber als geistiger Förderer dahinter zu stehen.
Einen Weihepunkt im Dorfleben soll das Volksfest bilden. Heute ist es beinahe ganz entschwunden oder oft ein [S. 49] Zerrbild eines solchen. Ein Volksfest führt nur dann mit Recht seinen Namen, wenn das ganze Volk wirklich ein Fest feiert, wenn es sich seelisch gehoben fühlt. Anlaß zu solchen Festen gibt es im Dorfe gar manche, sei es aus dem religiösen Leben, wie Weihnachten, aus der Geschichte (der Gedenktag, wie die Schweden das Dorf verließen), aus der bäuerlichen Tätigkeit (Erntefest), aus der Natur (Maifest) und ähnliche. Wie soll man dabei vorgehen? Ein paar Gedanken zum Weiterausspinnen! Weihnachten! Adventstimmung, ein Lichtbild oder lebendes Bild: Adam und Eva im Sündenelend und ihre Sehnsucht nach dem Erlöser; das ganze Volk singt dazu eine Strophe des „Tauet Himmel den Gerechten“. Dann Maria und Josef, Herberge suchend, dazu die schönen Volkslieder, „Anklöckllieder“ gewöhnlich genannt. Die Geburt unseres Heilandes, dazu das Weihnachtsevangelium vorgelesen! Leises Harmoniumspiel. Die Anbetung der Hirten. Ein religiöses Volkslied (Hirtenlied). Huldigung des Dorfes vor der Krippe. Kinder, Mütter, der Bauer, der Arbeiter erscheinen. Ein kurzes Schlußwort. Allgemeiner Gesang: Stille Nacht!
Oder das Erntefest. Gang von der Kirche zu einer Kapelle oder Statue auf freiem Felde. Festpredigt des Pfarrers. Kurzes Danklied. Zur Erinnerung werden die Erntekränze von Mädchen in Volkstracht nun ins Gotteshaus zurückgetragen, wo sie der Bürgermeister oder ein Bauernvertreter als Dankgabe auf den Altar niederlegt. Nachmittag auf freier Haide Schnittereinzug, Rundtänze und Gesang.
Grundbedingung für ein Fest ist wohl: Ohne Alkohol. Darum, wenn möglich, heraus aus dem Wirtshaus. Dann muß es gut vorbereitet werden, weil es meist etwas Neues ist, ferner muß jedem Gelegenheit geboten werden, dabei mitzutun. Kritisierende Zuschauer brauchen wir nicht und teilnahmslose Fremde auch nicht. Die stören und zerstören nur.
Mächtig ist in unserem Volke auch die Freude am Theaterspiel. Wie vielerorts haben sich noch trotz aller Ungunst die Krippenspiele, Paradeisspiele, Passionsspiele erhalten. In [S. 50] manchen Orten ließen sich vergessene Spiele wieder aufwecken oder neu einführen, anderswo wird sich wohl kein günstiger Boden dazu finden, gehört ja doch große Begeisterung zum Spiel und vor allem auch ein tüchtiger Leiter dazu. Vielleicht könnten einzelne besonders begünstigte Dörfer bestimmte Spiele besonders pflegen, zu denen dann die Bewohner der Umgebung hinpilgern könnten. So könnte wirklich Schönes geboten werden. Mustergültig sind wohl in dieser Hinsicht die großen Passionsspieldörfer Ober-Ammergau in Bayern, Erl und Thiersee in Tirol, auch St. Georgen ob Murau in Steiermark sowie neuestens Oetigheim bei Rastatt in Baden, wo Pfarrer Josef Saier Schauspiele, meistens Wilhelm Tell, mit seiner Gemeinde aufführt.
Unsere Vorfahren waren ein streitbares Geschlecht, das Körperkraft darum besonderes hoch schätzte. Noch heute steht Kraft und Stärke auf dem Lande in Ansehen, doch fehlt die allseitige Ausbildung, eine richtige Körperpflege. Den Weg dazu kann das Volksspiel ebnen. Auch da müssen wir ganz neu aufbauen. Vorerst wird es wohl sehr schwer gehen, gerade der Bauernstand hat für Körperübungen heute noch kein Interesse, er betrachtet sie als überflüssig. Und Spiele! Das ist etwas für die Schuljungen, er Erwachsener müßte sich schämen! Am meisten werden noch die Kampfspiele den Burschen zusagen. Vielleicht ließe sich in einem Burschenverein eine eigene Abteilung für körperliche Ertüchtigung gründen, die könnte nun mit Sport und Spiel den Anfang machen; Speerwerfen, Kugelstoßen, Keulenschleudern, Ballspiel und ähnliches betreiben. Zur Ausbildung des Körpers ließen sich dann Freiübungen einschieben. Ein gelegentliches Kampfspiel mit den Burschen des Nachbardorfes würde die allgemeine Anteilnahme des Dorfes gewiß wecken und viele mit diesen Übungen aussöhnen, die sie früher verachtet haben.
„Einst war in deutschen Landen das Volk so reich an Sang, Daß dir auf Weg und Steg sein Lied entgegenklang. Im Liede hat’s gebetet, im Liede hat’s geweint, Beim Mahle, wie bei Gräbern zum Sange sich vereint. [S. 51] Der Bauer hinterm Pfluge, der Hirt im Wiesental, Das Mädchen an dem Spinnrad, sie sangen allzumal; Und wo die Kinder spielten, da lenkt’ ein Lied die Lust, Und wo die Burschen zogen, da klang’s aus voller Brust.“ (K. Bormann)
Könnte es nicht wieder so werden! Soll das Volkslied erstorben sein. Pflegen wir es, indem wir die Leute bei Festen, Hochzeiten, an Sonntagabenden zum Singen bringen. Viel Verdienst könnten sich auch die Gesangsvereine auf dem Lande erwerben, wenn sie mehr das Volkslied pflegen würden. Eine Förderung durch die Schule halte ich derzeit nicht für erfolgreich, weil erfahrungsgemäß die jungen Leute keine „Schullieder“ singen wollen. Zur Pflege des Volksliedes gehört vor allem die Pflege des musikalischen Sinnes in der Familie, dann fängt das Volk allein wieder zu singen an, dann wird auch in den einzelnen Häusern die Hausmusik wieder erklingen. Man mag über die alte Schule denken wie man will, musik- und sangesfroher war sie gewiß als die heutige. Damals hat man Musik noch als Kunst geehrt, heute steht die Dorfmusik ganz unter dem Banne des Gelderwerbs und ist auch darnach.
Gute Bücher und Bilder wird man nur unter das Volk bringen können, wenn man ihm eine Auswahl vorlegt. Viel Interesse wird anfänglich nicht vorhanden sein. Für Bücher wäre eine Wanderbücherei zu empfehlen mit mehr unterhaltendem Inhalt. Belehrende Bücher sollen nicht ausgeliehen, sondern selbst gekauft werden. Doch muß unser Bauer erst Bücher studieren lernen. Am liebsten hat er noch kurze Erzählungen, die er mühelos an einem oder ein paar Abenden fertig lesen kann und die seinem Vorstellungsinhalt angemessen sind.
Ein Sorgenkind des Pfarrers war bisher die heranwachsende Jugend. In ihrem gährenden Freiheitsdrang wollte sie von Führung nichts wissen und war doch nicht fähig, allein sich das Leben zu gestalten. Scheu gingen die jungen Leute meist dem Pfarrer aus dem Wege und dieser [S. 52] verlor so den Zusammenhang mit einem wichtigen Teil seiner Pfarrkinder. Eine ordentliche Jugendpflege ist heute ein Gebot der Zeit. Kommen wir der schulentwachsenen Jugend mit Liebe und Vertrauen entgegen, sammeln wir sie, wo es angeht, in Burschen- oder Mädchenvereinen. Im freundlichen Verkehr mit den jungen Leuten läßt sich hier vieles zum Guten lenken, was sonst nicht möglich wäre, und wenn die Alten vielleicht für unsere bildnerischen Gedanken nicht mehr so empfänglich sind, die Jugend nimmt sie freudig auf und verarbeitet sie als Lebensgut. Gerade mit der Jugend läßt sich viel erreichen, nur muß man sie zu behandeln verstehen und das ist oft nicht leicht. Die besten Anleitungen dazu geben die beiden rührigen Sekretariate für männliche Jugend in Wien, I., Grashofgasse 3, und für die weibliche Jugend Wien, IX., Währinger Gürtel 102. Erfreulicherweise werden in den von diesen Sekretariaten veranstalteten Jugendführerkursen die Bedürfnisse der Landjugend immer mehr berücksichtigt.
Der lieben Schuljugend ließen sich durch Märchenabende mit Lichtbildern, Puppenspieltheater, Reigen manch vergnügte Stunden bereiten. Lehrwanderungen in die Stadt werden vorerst noch ein Zukunftstraum bleiben.
Wie könnte man dies alles durchführen, wird mir mancher entgegenhalten. Alles auf einmal? Das wäre gar nicht meine Meinung. Wo sich die Möglichkeit zeigt, da knüpfe man an und nun lasse man langsam immer etwas weniges Neues zuwachsen, daß es sich einlebe. Das Volk soll nicht die Meinung erhalten, daß da schon wieder etwas Neues komme. Nein, aus allen muß ihm ein liebes bekanntes Gesicht entgegenschauen, dann tut es gerne mit und tut es später selbst. Nur keine Übereilung und keine Übersättigung! Der Bauer hat Zeit und wir müssen es von ihm lernen.
So wäre des Pfarrers Volksbildungsarbeit beschaffen. Gibt uns Gott einmal eine echte ländliche Volkshochschule oder Lebensschule, wie ich sie nennen möchte, dann wird unsere Arbeit leichter sein. Heute ist es wohl noch ein Pfadfinden und Wege bereiten. Große Hilfe könnte uns auch noch [S. 53] der planmäßige Ausbau und die Verbreitung der ländlichen Fortbildungs- und kleinbäuerlichen Haushaltungsschulen unter Leitung einer fachkundigen Oberstelle bringen, wie es in Steiermark durch das Landesamt für bäuerliche Volksbildung unter der mustergültigen Leitung Steinbergers in St. Martin bei Graz geschieht. Freudig wollen wir auch die Mitarbeit der anderen Stände begrüßen, vor allem des Lehrerstandes. Zwei Männer, Grundtvig und Kold, ein Priester und ein Lehrer, haben die Volksbildungsstätten des Nordens geschaffen, Priester und Lehrer sollen auch einig arbeiten zum Wohle des deutschen Volkes.
Kein Priester auf dem Lande wäre imstande, sich alle Hilfsmittel für Volksbildung selbst zu verschaffen. Braucht er Rat und Hilfe, dann wende er sich vertrauensvoll an den Landesreferenten für Volksbildungswesen in seinem Bundeslande. Mögen uns von dort aus bald alle Hilfsmittel, vor allem Lichtbilder für Heimat- und Bauernkunde, zur Verfügung gestellt werden können. Vielen Segen hätten auch jährliche Kurse für bäuerliche Volksbildungsarbeit, aus denen sich dann eine Arbeitsgemeinschaft herausentwickeln könnte.
Ein Mittelpunkt für unsere volkserzieherische Tätigkeit fehlt uns noch. Das wäre das Gemeindehaus, ein eigenes Heim in der Gemeinde, das die Stütze für unsere Arbeit werden könnte.
„Ade zur guten Nacht; jetzt ist der Schluß gemacht, daß ich muß scheiden,“ so sage ich mit dem Volksliede. Es gäbe noch manches zu besprechen, doch wozu. Jedes Priesterherz, das in Liebe zu seinem Volke schlägt und das ist jedes von uns, das wird auch den rechten Weg finden, seinem armen und doch so geliebten Volke vorwärts zu helfen. „Mich erbarmt des Volkes,“ hat einst der Herr gesagt; diese seine Worte seien und Vorbild und Führer.
„Man nahm uns viel, doch viel ist uns geblieben.
Und was uns blieb, das laßt uns umso besser lieben.“
(Kernstock)
Anmerkungen:
1 [S. 6 ] Laßmann, Unsere Landgemeinden und das Gemeindeideal, S. 26.
2 [S. 10 ] Das Land, 26. Jg., S. 25.
3 [S. 11 ] Dorffrühling und Dorfheim, S. 30.
4 [S. 12 ] Von Volkstum und Heimat, S. 70.
5 [S. 21 ] Volksbildung, 2. Jahrgang, S. 211.
6 [S. 23 ] H. Rebensburg, Das deutsche Dorf, Süddeutschland, S. 7.
7 [S. 24 ] Heimatmission und Dorfkultur, S. 11.
8 [S. 32 ] Rebensburg, Das Deutsche Dorf, Süddeutschland, S. 10.
9 [S.36 ] Gedanken über Ausschmückung von Landkirchen, S. 27.
10 [S. 40 ] Von Volkstum und Heimat, S. 76.
11 [S. 45 ] Wie erhalten wie das Bauerntum? S. 12.
(Wortwahl, Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung entsprechen dem Original. Die im Original durch Sperrung hervorgehobenen Wörter wurden kursiv gesetzt. Die im Original mit Sternchen gekennzeichneten Fußnoten wurden als Endnoten wiedergegeben. In eckiger Klammer steht die Zahl der jeweiligen Seite des Originaltextes. Offensichtliche Druckfehler wurden berichtigt.)