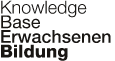Drum lasst uns lügen!
Titelvollanzeige
| Autor/in: | Liessmann, Konrad Paul |
|---|---|
| Titel: | Drum lasst uns lügen! |
| Jahr: | 2013 |
| Quelle: | Die Presse, 16.11.2013, Beilage Spectrum, S. I-II. |
[S. I] Kunst lügt immer, so Nietzsche. Und wir haben die Kunst, damit wir an der Wirklichkeit nicht zugrunde gehen. Über das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst und den Willen des Menschen zum Schein.
Kunst und Wissenschaft haben zumindest eines gemeinsam: Sie werden gerne in einem Atemzug genannt. Und dies nicht nur hier und heute. Dieser Atemzug hat Tradition, und was über die Wissenschaften gesagt wird, trifft dann auch die Künste und vice versa. Ein Beispiel? Als im Jahre 1749 die Akademie von Dijon die Preisfrage stellte: „Hat die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste dazu beigetragen, die Sitten zu reinigen?“, hatte der damals noch junge und unbekannte Jean-Jacques Rousseau die kecke Idee, diese Frage mit einem glatten Nein zu beantworten. Und das Besondere daran: Er gewann diesen Preis.
Das ist ungefähr so, wie wenn heute jemand die Frage, ob die Wissenschaften und Künste die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes steigern, mit einem glatten Nein beantwortete und daraufhin vom Wissenschafts- und Kunstministerium gleichermaßen geehrt werden würde. Natürlich könnte man sagen, für die Künste mag dieses Nein wohl zutreffen, nicht aber für die Wissenschaften. Oder umgekehrt. Aber das Interessante besteht eben in diesem gemeinsamen Atemzug: beide oder keine.
Beide oder keine? Seit wann und warum treten Wissenschaften und Künste gemeinsam auf? Und gab es nicht doch auch Zeiten des Zerwürfnisses, der Konkurrenz und der wechselseitigen Aberkennung der Fähigkeit, etwas zur Verbesserung des Menschengeschlechts beitragen zu können? Doch, natürlich gab es diese Zeiten, und auch noch manche andere, und einiges ist daran bis heute ziemlich bemerkenswert. So könnte man die Geschichte der Künste und Wissenschaften seit dem Mittelalter mit folgenden Paradoxien beschreiben: Als die Wissenschaften noch Künste waren, gab es keine Kunst. Als die Künste entstanden, waren sie Wissenschaften. Und als sich endlich die Wissenschaften als Wissenschaften und die Künste als Künste begriffen, nährte dies nur den Verdacht oder auch den Wunsch, dass die Wissenschaften eigentliche Künste und die Künste letztlich doch Wissenschaften seien. Wie das?
Zur Erinnerung: Die modernen Wissenschaften waren aus der mittelalterlichen „Artistenfakultät“ hervorgegangen, an denen die seit der Spätantike praktizierten septem artes liberales, die sieben freien Künste, gelehrt worden waren: Grammatik, Rhetorik, Dialektik (Trivium), Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie (Quadrivium). Frei waren diese Künste im Gegensatz zu den an anderen Orten geübten artes mechanicae oder artes vulgares, den praktischen Künsten, gewesen, ebenfalls sieben an der Zahl: Webekunst, Waffenschmiedekunst, Bauhandwerk (also Steinmetzen und Maurer), Schifffahrt, Jagd, Heilkunst und Schauspielkunst.
Diese Künste galten aus zwei Gründen als unfrei. Einmal, weil derjenige, der sie ausübt, bestimmten Notwendigkeiten unterliegt, er muss zum Beispiel Rücksicht nehmen auf Materialbeschaffenheit und Naturgegebenheiten; zum anderen aber, weil im Gegensatz zu den freien Künsten auch sozial Unfreie diese praktischen Tätigkeiten durchführen konnten. Die schönen Künste allerdings, also das, was wir heute unter „Kunst“ im Sinne einer ästhetisch-kulturellen Praxis verstehen, haben sich überhaupt erst im 18. Jahrhundert aus den artes mechanicae entwickelt und von diesen emanzipiert: Malkunst, Bildhauerei, Tanzkunst, Musik, Poesie, Architektur und Rhetorik. Als der französische Ästhetiker Charles Batteux um 1750 diese Einteilung der schönen Künste, der beaux-arts, vornahm, nannte er diese theoretisch-reflexive Beschäftigung mit der Kunst allerdings noch eine schöne Wissenschaft. Aus diesen schönen Wissenschaften, den belles-lettres, haben sich allerdings etymologisch dann nicht die Kunst- und Geisteswissenschaften entwickelt, sondern die Belletristik: die schöne Literatur, im Gegensatz zur wissenschaftlichen Literatur, wie sie an der Universität gelehrt wurde, die ja als universitas litterarum die Gesamtheit der – schriftlich ausdrückbaren und fixierbaren – Wissenschaften repräsentieren sollte. Freie Künste, mechanische Künste, schöne Künste. Ursprünglich waren sie alle Künste, und das lateinische ars hat dies noch tatsächlich enthalten: das Wissen und die Technik, die Fertigkeit und das Schöne, die Kunst und die Wissenschaft.
Die Künste, die artes, waren der Oberbegriff, und dass wir dies nicht vergessen, dafür sorgt der „Bologna-Prozess“, also die aktuelle Neuordnung unseres europäischen Hochschulwesens. Dass in Zukunft im Zuge dieser Reform nun alle geistes- und kulturwissenschaftlichen Studien mit einem „Bachelor of Arts“ oder „Master of Arts“ abgeschlossen werden, hat weniger damit zu tun, dass diese Wissenschaftler nun schöne Literatur produzieren, sondern stellt eine nur wenigen Menschen bewusste Reminiszenz an die artes liberales als historische Grundlage dieser Studien dar. Die wirklichen Künstler, die Absolventen einer Kunstuniversität, werden deshalb mancherorts zu „Masters of Fine Arts“.
Einen letzten Höhepunkt erlebte die Einheit von Kunst und Wissenschaft im Typus des Renaissancekünstlers, der – wie Leonardo oder Michelangelo – sich selbst als ein gottgleiches, hervorbringendes, schaffendes Wesen sah, für das Wissen und Kreativität, Fantasie und Technik, Theorie und Praxis tatsächlich noch eine Einheit bilden konnten. Spätestens seit dem 17. Jahrhundert findet jedoch ein Differenzierungsprozess statt, der die Wissenschaften auf Wahrheit, die Künste freilich auf Schönheit verpflichtete, ohne dass die alte metaphysische Formel von der Einheit des Wahren und Schönen (und Guten) noch bruchlos aufrechterhalten werden konnte.
Dieser Prozess kann nicht rückgängig gemacht werden, er hat sich aber auch nicht vollständig durchführen lassen. Kunst und Wissenschaft stehen seitdem in einem Spannungsverhältnis, das am fruchtbarsten dann ist, wenn sich diese Disziplinen wechselseitig beobachten und durchdringen und dabei die Erfahrung machen, wie viel vom anderen sie selbst noch immer enthalten. Es ist kein Geheimnis, in welch hohem Maße ästhetische Kriterien wie Schönheit, Eleganz, Symmetrie, Geschlossenheit und Vollständigkeit, aber auch Fiktionalität – ich sage hier [S. II] nur: Gedankenexperimente und Science-Fiction – auch in Formal- und Naturwissenschaften entscheidende Bedeutung zukommt; es ist ebenfalls kein Geheimnis, dass keine historische Wissenschaft ohne narrative Elemente und Strukturen, also ohne das poetische Moment der Erzählung, auskommt; und ob die Psychoanalyse Sigmund Freuds große Wissenschaft oder große Literatur oder beides war, darüber lässt sich noch immer trefflich streiten.
Aber es geht auch umgekehrt. Künstlerische Verfahren ähneln oft wissenschaftlichen Vorgangsweisen, Beobachtung, Protokoll und Experiment spielen auch in der Kunst und Literatur eine entscheidende Rolle, die Grenze zwischen Software-Ingenieuren und Computer-Künstlern ist fließend, und man kann durchaus der Ansicht sein, dass der große Gesellschaftsroman des 19. Jahrhunderts, wie er sich bei Balzac, Flaubert, Dostojewski oder Fontane, ja noch bei Thomas Mann findet, eigentlich eine großartige und erkenntnisreiche Soziologie darstellt. Allerdings: Würde man wirklich ernsthaft behaupten, dass sich groß angelegte empirische Studien über Entscheidungsverhalten von Topunternehmen in ökonomischen Krisenzeiten durch die Lektüre von – sagen wir einmal – Thomas Manns „Buddenbrooks“ ersetzen ließen, wäre nicht nur mit einem Aufschrei der um ihre Drittmittel bangenden Sozialwissenschaftler zu rechnen, sondern man würde dem Gehalt dieses Romans im Ernstfall dann eher doch nicht den Wert einer seriösen wissenschaftlichen Quelle zuerkennen.
Allerdings: Man kann, ja man muss auch die Künste zum Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung machen. Schon Hegel hatte die Vermutung geäußert, dass die Wissenschaft von der Kunst in einem wissenschaftlichen Zeitalter wichtiger wird als die Kunst selbst. Und man könnte in der grassierenden Sehnsucht nach der Szientifizierung der Künste, ihrer Akademisierung und Verwissenschaftlichung, auch eine Bestätigung von Hegels These sehen: Die Kunst als freie Betätigung subjektiver Imaginationskraft, die eine Wahrheit zum Erscheinen bringen will, ist am Ende. Als Wissenschaft aber gibt sie womöglich auch das auf, was sie einst zur Kunst machte.
Und wenn wir das Ganze von der anderen Seite betrachten? Was, wenn nicht die Kunst wissenschaftlich werden muss, weil die Wissenschaft selbst ohnehin auch nur eine Form von Kunst ist? Was bedeutete es, wenn man tatsächlich radikal die Perspektiven wechselte und die moderne Wissenschaft tatsächlich so betrachtete, als wäre sie eine Kunst? Der aus Österreich stammende, lange in den USA und später auch in der Schweiz lehrende „anarchistische“ Erkenntnistheoretiker und Philosoph Paul Feyerabend hat dies versucht, und die Konsequenz dieses Versuches war die Einsicht, dass man sich dann für oder gegen eine wissenschaftliche Theorie so zu entscheiden habe wie für oder gegen Punk-Rock. Aus vermeintlichen Wahrheitsfragen werden Geschmacks- und Stilfragen. Nicht das bessere Argument zählte dann, sondern eine ästhetische Präferenz. Unter dieser Perspektive wäre ein Satz denkbar wie: Ich lehne die Relativitätstheorie oder die Gesetze der Optik ab, weil sie mir nicht gefallen. Es geht und ging übrigens auch umgekehrt. Ob man sich für oder gegen Strawinsky entscheidet, war zum Beispiel nach Theodor W. Adorno, den ich nach wie vor für den bedeutendsten Kunstphilosophen des 20. Jahrhunderts halte, keine Geschmacksfrage, sondern eine Wahrheitsfrage. Unter dieser Perspektive wiederum wäre ein Satz durchaus denkbar wie: Ich kann Strawinsky nicht hören, weil dieser falsche Musik komponierte.
Mit solch einem Perspektivenwechsel mag man vielleicht hier und dort noch und vielleicht auch schon wieder verblüffen, doch gerät an dieser Stelle etwas durcheinander. Nämlich die vielleicht von Immanuel Kant am schärfsten formulierte Einsicht in die Differenz zwischen der reinen Vernunft einerseits, der es um Erkenntnisse und ihre Grenzen geht und deren Legitimität in der objektiven Kraft ihrer Argumente ruht, und der ästhetischen Urteilskraft andererseits, der es letztlich auf das Beurteilungsvermögen des Schönen ankommt, das sein Fundament in der sinnlichen Evidenz des subjektiven Geschmacks hat. Wissenschaft überzeugt durch die Plausibilität ihrer Argumente, Kunst beeindruckt durch die Weise ihres Erscheinens. Man kann es auch anders formulieren: Das Leitmedium der Wissenschaft ist auch dann die Wahrheit, wenn diese selbst nur eine Imagination sein sollte, das Leitmedium der Kunst ist auch dann die Schönheit oder die ästhetische Stimmigkeit, wenn Kunst etwas ganz anderes sein möchte. Oder, um es mit aller gebotenen Zweideutigkeit zu sagen: Wissenschaft ist keine Kunst!
Wissenschaft ist keine Kunst. Aber Kunst ist auch keine Forschung. Im Gegensatz zu den Kooperations- und Vernetzungsgeboten der Gegenwart möchte ich an dem Spannungsverhältnis von Kunst und Wissenschaft letztlich nicht das Gemeinsame, sondern das Trennende betonen, das, was Kunst und Wissenschaft durchaus als zutiefst different erfahren müssen. Seit der Romantik hat sich Kunst ganz bewusst und immer wieder in pointierter Form als Konkurrentin und große Gegenspielerin der neuen, modernen wissenschaftlichen Vernunft zu etablieren versucht, und die romantische Sehnsucht, dass die rationale, intellektuelle Erklärung der Welt durch ästhetische Emotionalität wenn nicht widerlegt, dann wenigstens korrigiert und ergänzt werden soll, kommt immer wieder zum Ausbruch.
Es war Friedrich Nietzsche, der versucht hatte, die Kunst radikal von jeder Verpflichtung auf Wahrheit oder Moral zu befreien. So notierte er in einem späten Fragment einmal die folgenden, nicht gerade feinen Sätze: „An einem Philosophen ist es eine Nichtswürdigkeit zu sagen: das Gute und das Schöne sind Eins: fügt er gar noch hinzu ,auch das Wahre‘, so soll man ihn prügeln.“ Kunst, so Nietzsche, lügt immer. Und wir haben die Kunst, damit wir an der Wahrheit nicht zugrunde gehen. Allerdings: Gerade in diesem Beharren am Imaginären und Fiktionalen, im Willen, etwas, was nicht ist oder nicht gesehen oder gehört werden kann, zum Erscheinen zu bringen, liegt auch, aller Wissenschaftlichkeit unseres Wissens zum Trotz, die Priorität der Kunst gegenüber der Wissenschaft verborgen.
In den „Nachgelassenen Fragmenten“ Nietzsches findet sich ein Satz, der zu verdeutlichen sucht, warum die Kunst gegenüber der Wissenschaft immer vorrangig sein wird: „Der Wille zum Schein, zur Illusion, zur Täuschung, zum Werden und Wechseln ist tiefer, ,metaphysischer‘ als der Wille zur Wahrheit, zur Wirklichkeit, zum Sein: Die Lust ist ursprünglicher als der Schmerz.“ Im Grunde enthält dieser Satz – lange vor Sigmund Freud – eine tiefenpsychologische Sensation: Den Willen des Menschen zum Schein, und damit zur Fiktion, zur Unwahrheit und zur Lüge, aber damit auch zur Kunst, begründet Nietzsche damit, dass die Lust ursprünglicher ist als der Schmerz. Einerseits ist damit eine erste präfreudianische Fassung der Opposition von Lustprinzip und Realitätsprinzip formuliert. Aber anders als später bei Freud ist nicht die Sexualität die Quelle der Lust, sondern die Imagination, die Fantasie, die Freiheit, der Wirklichkeit eine eigene Fassung zu geben oder sie überhaupt erst zu erfinden; die Realität aber ist schmerzhaft, und nur was schmerzhaft ist, ist wahr. Eine Wissenschaft, die tatsächlich auf Wahrheit aus wäre, liefe so immer Gefahr, von der Kunst überblendet zu werden.
Die Wahrheit, wenn sie denn erkennbar wäre, müsste nach Nietzsche abgewehrt werden, weil sie uns nur als schmerzhaftes factum brutum entgegentreten könnte, auf das wir immer schon mit dem Entwurf imaginärer Welten reagieren wollen und reagieren müssen. Vielleicht fällt deshalb den zeitgenössischen Wissenschaften der Verzicht auf die Verpflichtung zur Wahrheit als methodische Maxime so leicht. Die Lust am Schein, an der Täuschung und an der Fiktion ist auch hier größer. Anstatt von Wahrheit spricht man deshalb lieber von Effizienz, Internationalisierung, bibliometrisch ermittelter Exzellenz, Zukunftsinnovationen, Drittmitteln und Wettbewerbsvorteilen – letztlich alles bombastische Illusionierungsstrategien. Die Künste hätten diesen Strategien gegenüber allemal den Vorteil, dass sie sich den großen Aufwand, der umfassende Selbsttäuschung nun einmal mit sich bringt, sparen könnten: Sie haben es nicht notwendig, ihre Fiktionen als Realität zu behaupten.
Der entscheidende Unterschied zwischen Wissenschaft und Kunst aber liegt in der Differenz von Allgemeinem und Besonderem. Während die Wissenschaften über Natur und Mensch, Kosmos und Gesellschaft allgemein verbindliche und generell nachvollziehbare Aussagen, Hypothesen und Theorien formulieren, lebt die Kunst vom Besonderen, vom Singulären, vom Werk. Kein Kunstwerk enthält eine allgemeine Hypothese über die Welt, aber jedes stellt eine besondere Welt für sich dar. Ob und wie Kunstwerke allgemeinen Gesichtspunkten untergeordnet werden können, ist zwar für die Kunstwissenschaft eine Frage und methodische Herausforderung, nicht aber für Kunst selbst. Und sogar in jenen Fällen, in denen – zumindest nach der These des vor Kurzem verstorbenen amerikanischen Philosophen Arthur C. Danto – Kunstwerke eine Theorie benötigen, um überhaupt als solche wahrgenommen werden zu können, weil sie sich von Alltagsgegenständen nicht mehr unterscheiden, dient die kunstwissenschaftliche oder philosophische Theorie dazu, das Kunstwerk eben in seiner Besonderheit und Individualität zu behaupten.
Andy Warhols Brillo-Boxes fallen eben aus allen anderen serienmäßig gefertigten Brillo-Boxes heraus. So sehr die Wiederholbarkeit und die Reproduktion des Identischen mit identischen Mitteln unter identischen Bedingungen in der Wissenschaft und in der industriellen Produktion ein entscheidendes methodisches Prinzip darstellt, so sehr ist das Erst- und Einmalige in der Kunst, letztlich das Unwiederholbare, nach wie vor ihr entscheidender Maßstab. Sogar dort, wo jemand etwas wiederholt, was ein anderer schon gemacht hat – man denke an die Appropriation Art –, kommt es darauf an, wer damit beginnt und wie er es macht. Die Annahme von Walter Benjamin, dass das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit seine durch Originalität, Einmaligkeit und Erscheinen im Hier und Jetzt begründete Aura verliere, gehört wohl zu den am besten widerlegten Thesen der neueren Kunstphilosophie.
Zur These vom unverwechselbaren Charakter der Kunst im Gegensatz zum universellen Charakter der Wissenschaft gehört auch die Einsicht, dass Kunst als ein Referenzsystem betrachtet werden muss, das sich über die je hervorgebrachten Werke, Konzepte und Aktionen selbst generiert und verändert, während die Wissenschaft, bei aller Selbstbezüglichkeit, um die empirische Welt als letzten Referenzrahmen nicht herumkommt. Das erlaubt es auch, Wissenschaft als ein Unternehmen zu sehen, das von kreativen und unorthodox denkenden Forschern zwar vorangetrieben, aber nicht wesentlich durch deren Individualität bestimmt werden kann. Was ein Forscherteam in Toronto nicht schafft, schafft eben ein anderes in Genf. Anders in der Kunst: Der Roman, der von einem Schriftsteller nicht geschrieben wird, wird auch von keinem anderen geschrieben. Mit jedem wirklich kreativen Akt ändert sich die Bedeutung der Kunst, und es wird eine Perspektive eröffnet, die es ohne diesen individuellen Akt in dieser Form nie gegeben hätte. Die flächendeckende Verwissenschaftlichung der Künste wird zwar Normierungs- und Standardisierungsprozesse befördern, die Kunst aber damit um das bringen, was ihre Eigenart ausmacht.
Es ist also nicht der Gleichklang, es ist die Differenz von Wahrheit und Geschmack, von Vernunft und Sinnlichkeit, von Empirie und Einbildungskraft, von Rationalität und Emotionalität, von Allgemeinem und Besonderem, die das Zwiegespräch von Wissenschaft und Kunst, ihre Überschneidungen und Überlappungen, ihre Ausfransungen und Verdichtungen, ihre Verständnisse und Missverständnisse, ihre Ansätze und Gegensätze erst zu einem spannenden, produktiven und aufregenden Verfahren macht.
(Wortwahl, Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung entsprechen dem Original. Hervorhebungen im Original durch Kursivdruck werden gleichfalls durch kursive Schrift wiedergegeben. Offensichtliche Druckfehler wurden berichtigt. Die Seitenzahlen in eckigen Klammern bezeichnen den Beginn der jeweiligen Seite des Originals.)